Gehe zu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Mouseover für Erläuterungen)
E
Ebbe in der Kasse...ist, wenn kein Geld mehr da, das Konto geplündert, der Geldbeutel leer ist. Die Wendung geht natürlich auf den durch die Gezeiten zweimal täglich fallenden Meeresspiegel zurück. Ebenso wie beim Wasser erwarten wir, daß bald eine »Flut« kommt und das Portemonnaie wieder füllt.
Echternacher SpringprozessionDiese religiöse Prozession, die schon seit dem Mittelalter jedes Jahr am Dienstag nach Pfingsten in Echternach in Luxemburg stattfindet, steht als Synonym für eine sehr schleppende, mit vielen Rückschlägen verbundene Verhandlung. Die Teilnehmer »springen« zu Polkamelodien in Reihen durch die Straßen der Stadt zum Grab des Heiligen Willibrord in der Basilika. Die ursprüngliche Sprungfolge - drei Schritte vor und zwei zurück - wurde 1947 abgeschafft, da dies zu einem riesigen Chaos führte...
Edel sei der Mensch, hilfreich und gutDiese freundliche Aufforderung geht auf den Dichter, Dramatiker, Theaterleiter, Kunsttheoretiker, Naturwissenschaftler und Staatsmann Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zurück. In seinem humanistischen Gedicht »Das Göttliche« ruft er seine Mitmenschen auf, edel, hilfreich und gut zu sein, denn nur so könnten sie den Göttern gleichen oder diesen gar zum Vorbild werden:
»Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen«...
Egal ist 88...zielt auf die Tatsache ab, daß man die 88 umdrehen, auf den Kopf stellen und die Ziffern vertauschen kann - die Erscheinung bleibt im Großen und Ganzen immer gleich, wie man es auch dreht, die 88 sieht immer wie eine 88 aus.
Eher friert die Hölle zu...behaupten wir, um auszudrücken, daß etwas nie und nimmer eintreten wird. Da man sich in der Theologie die Hölle als Ort größter Hitze und brodelnder Flammen ausmalte, lag ihr Zufrieren jenseits aller Vorstellungskraft. Besser geeignet wäre da schon die Hölle in der nordischen Mythologie. Sie galt als trostloser, kalter Ort, an dem die Todesgöttin »Hel« herrschte. Von ihrem Namen leitet sich das Wort Hölle (englisch: hell) ab.
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr...behaupten wir manchmal skeptisch, wenn uns etwas völlig unmöglich, nicht machbar erscheint. Schon im Neuen Testament kann man lesen, daß Jesus zu seinen Jüngern sprach: »Et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum cælorum«. Martin Luther übersetzte 1546: »Vnd weiter sage ich euch, Es ist leichter das ein Kamel durch ein nadel oehre gehe, denn das ein Reicher ins reich Gottes kome« (Matthäus 19:24). Die Bedeutung von »Nadelöhr« ist allerdings umstritten: Es könnte sich um ein sehr enges Jerusalemer Stadttor gehandelt haben, das im Volksmund tatsächlich so hieß und durch das die vollbeladenen Kamele der Händler tatsächlich nicht hindurchpaßten - wahrscheinlicher ist indes ein Übersetzungsfehler aus dem Griechischen: Die beiden Vokabeln »καμιλος« (kamilos - Seil, Schiffstau) und »κάμηλος« (kámêlos - Kamel, Karawane) unterschieden sich lediglich durch einen einzigen kleinen Buchstaben. Auch im Koran können wir über die Sünder lesen: »Es wird keine Öffnung des Himmelstores geben, noch werden sie den Garten Gottes betreten, bevor nicht ein Kamel durch ein Nadelöhr paßt«, im babylonischen Talmud heißt es über die Bedeutung von Träumen: »Sie zeigen weder eine Palme aus Gold, noch einen Elefanten, der durch ein Nadelöhr gehen kann«.
Ehernes GesetzDieses unumstößliche Gesetz ist, wie so oft, zuerst bei Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zu finden. Er verwendet es in seinem Gedicht »Das Göttliche«: »Nach ewigen, ehernen großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden«.
Ehre, wem Ehre gebührt...bescheinigen wir gern jemandem, der eine besondere Leistung vollbracht hat und in falscher Bescheidenheit jedes Lob von sich weist. Wer etwas ganz besonders gut gemacht hat, sollte natürlich auch seinen verdienten Dank und die Ehre für diese Leistung bekommen.
Hier handelt es sich um ein Zitat von Paulus von Tarsus aus dem Neuen Testament der Bibel (Römer 13.7), der die Christen dazu auffordert, die politische und soziale Ordnung zu respektieren: »Reddite omnibus debita cui tributum tributum cui vectigal vectigal cui timorem timorem cui honorem honorem«. - »So gebet nu jederman, was jr schueldig seid, Schos, dem der schos gebuert, Zol, dem der zol gebuert, Furcht, dem die furcht geburt, Ehre, dem die ehre gebuert« oder kurz: »Cui honorem, honorem«.
Ehrenrunde...nennen sitzengebliebene Schüler euphemistisch die Wiederholung eines Schuljahrs. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Sport, wo der Wettkampfsieger oft noch eine zusätzliche Runde durchs Stadion oder über die Rennstrecke dreht, um sich seinen verdienten Applaus abzuholen.
Ei der Daus...sagen wir seit dem 15. Jahrhundert als Ausdruck der Verwunderung, aber auch des Fluches, Erstaunens oder Schreckens. Zunächst bedeutete es »Betrüger«, niederdeutsch auch »Teufel«, seit dem 18. Jahrhundert ist die Bedeutung »Teufelskerl« (von mittellatenisch »dusius« - Dämon), traditionell ein Euphemismus für den Teufel oder Henker bezeugt. Grund ist der verbreitete Aberglaube, daß die Nennung des Teufels ihn höchstselbst herbeirufen könnte. Bei Klabund (1890-1928) heißt es im »Totengräber«:
»Ich rede frisch von der Leber
Weg, zum Parlieren
Und Zieren
Ist keine Zeit.
Ein armer, wandernder, stellenloser Totengräber
Bittet um Arbeit.
Habt ihr keinen Toten zu begraben?
Keine Leiche im Haus?
Ei der Daus!
Keine Mutter? Keine Tochter? Keinen Mann?
Ich begrabe sie, so gut ichs kann.
Bei mir ist jeder gut aufgehoben,
Das Werk wird seinen Schöpfer loben.
Ich trage die Schaufel stets bei mir
Und begrabe Sie auf Wunsch im Garten hier.
Die Erde leicht und lau fällt
Auf Ihre Rippen
Wie Schnee.
Ein Grab ist schnell geschaufelt.
Die Lippen
Lächeln: Ade«
Möglich wäre auch die entgegengesetzte Herleitung über »Deus« (lateinisch »Gott«). Eine andere Deutung: Im Kartenspiel wird eine Karte mit hohem Wert auch als »Daus« (vom nordfranzösischen »daus«, französisch »deux« - zwei, weil zwei Symbole und ein Glücksschwein zu sehen sind) oder »Sau« bezeichnet. Das Ausspielen der Karte wird oft mit Überraschung aufgenommen, dementsprechend folgt gelegentlich dieser Ausruf. »Daus« waren darüber hinaus auch zwei Augen beim Würfelspiel (mittelhochdeutsch »dus«, lateinisch »duo«).
Ei des Kolumbus...nennen wir eine verblüffend einfache Lösung für ein schier unlösbares Problem:
In dem Buch »Historia del mondo nuovo« (Geschichte der Neuen Welt) des Historikers Girolamo Benzoni (1519-70) aus dem Jahre 1565 heißt es, man habe Christoph Kolumbus (1451-1506) während eines Essens bei Kardinal Mendoza 1493 vorgehalten, es sei ein Leichtes gewesen, die »Neue Welt« zu entdecken. Der verlangte von den Anwesenden, ein Ei auf der Spitze aufzustellen. Es wurden viele Versuche unternommen, niemand schaffte es, schließlich schlägt Kolumbus sein Ei mit der Spitze auf den Tisch, sodaß sie leicht eingedrückt wird, und siehe - das Ei bleibt stehen...
Ursprünglich war die Anekdote aus Giorgio Versaris »Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti« auf den Renaissance-Baumeister Filippo Brunelleschi (1377-1446) gemünzt, der durch die Lösung des »Ei-Problems« den Auftrag zum Bau der Kuppel des Doms Santa Maria del Fiore, die augenscheinlich die Form eines an der Spitze aufgestoßenen Eis hat, erhalten haben soll.
Eichen sollst Du weichen - Buchen sollst Du suchen...geistert eine Volksweisheit schon seit Generationen durch unsere Köpfe:
»Vor den Eichen sollst Du weichen
Und die Weiden sollst Du meiden.
Zu den Fichten flieh mitnichten
(sive:) Unter Fichten sollst Du flüchten
Doch die Buchen sollst Du suchen
Und die Linden sollst Du finden«.
Potzblitz und Donnerwetter - dem Blitz ist wurschtegal, an welche Bäume, Reime oder Sprichworte die Menschen glauben. Allein die beiden diametralen Formen, die uns den korrekten Umgang mit Fichten ans Herz legen, zeugen von höchst zweifelhaftem Rat. Möglich, daß man Buchen empfahl, weil diese oft in Gruppen vorkommen, während Eichen eher solitär in der Landschaft herumstehen. Auch die verschiedenartige Rinde könnte unsere Ahnen inspiriert haben: Die dicke, zerklüftete, oft moosbewachsene Borke der Eiche, die das Wasser aufsaugt wie ein Schwamm, ist sensibel für die elektrische Entladung. Trifft der Blitz auf dieses Wasser, verdampft es schlagartig in regelrechten Sprengungen, weshalb vollgesaugte Eichenstämme bersten können. Die glatte Buchenrinde leitet den Blitz hingegen direkt in den Boden, ohne daß sichtbare Schäden entstehen. Zudem lassen die langen Pfahlwurzeln der Eiche, die oft bis ins Grundwasser hinabreichen, diese Bäume häufiger zu Blitzopfern werden, als Buchen mit ihren flachen Herzwurzeln. Fatal kann es allerdings für jeden ausgehen, der Schutz unter Bäumen sucht. Am sichersten ist man während eines Gewitters noch immer im Haus oder im Auto aufgehoben - notfalls kauert man sich auf den Boden und zieht in der Hocke die Arme an den Körper und den Kopf ein.
Eier sind für Mama gut, wenn sie Papa essen tutDie Hoffnung, daß der ausgiebige Verzehr von Eiern uns potenter machen könnte, ist natürlich ein Ammenmärchen. Zu einer gesunden Libido gehört sicher nicht zuletzt auch eine gesunde Ernährung und die sogenannten »potenzsteigernden« Lebensmittel gibt es tatsächlich - allerdings halten sie nur höchst selten das, was sie versprechen.
Aber wer weiß? Wenn man nur fest genug daran glaubt...
EierdiebSicherlich ist er strenggenommen kriminell, aber sein Vergehen doch eigentlich nur marginal, kaum erwähnenswert. Früher gab es dafür noch den »Mundraub« - ein Hungriger beschaffte sich etwas zum Essen - der im Regelfall straflos blieb.
Eierlegende Wollmilchsau...nennen wir bisweilen Sachen oder Personen, die unterschiedlichste Aufgaben erfüllen. Dieser Vergleich mit einem imaginären Nutztier, das den Menschen rundum mit Nahrung und Kleidung versorgt und das ebenso grandios nützlich wie unrealisierbar ist, ist bereits 1959 in einem launigen Gedicht von Ludwig Renn (1889-1979) belegt und ab Ende der 60er-Jahre als Redensart verbreitet:
»Was wir brauchen, ist ein Schwein,
Das Merinowolle trägt
Und dazu noch Eier legt.
Das soll Ihre Züchtung sein!«
(Ludwig Renn zum 70. Geburtstag, Aufbau-Verlag Berlin, 1959, S. 135 »Der Kampf um das eierlegende Wollschwein«)
Eiertanz...heißt, daß jemand ganz besonders vorsichtig oder sehr kompliziert und umständlich vorgeht und nicht auf den Kern einer Sache kommt. Was heute oft auch als »Herumeiern« bezeichnet wird, geht auf ein Erlebnis Johann Wolfgang Goethes (1749-1832 ) zurück, das er 1795/96 in seinem Bildungsroman »Wilhelm Meisters Lehrjahre« verarbeitete: Darin tanzt das Mädchen Mignon mit verbundenen Augen und Kastagnetten zwischen in einem bestimmten Muster auf einem Teppich liegenden Eiern hindurch, ohne nur ein einziges zu berühren oder gar zu beschädigen.
1865 findet sich der »Eiertanz« auch als Karikatur in der »Berliner Zeitung«: Bismarck tanzt - wie einst beschrieben - zwischen rohen Eiern, die für Verfassung, Gesetze, Presseverordnung, Wahlen, Recht und Reformen stehen.
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafftDieses Sprichwort wird sowohl gelegentlich Franz Grillparzer (1791-1872) zugeschrieben, der es in seinen »Epigrammen« 1830 veröffentlichte, als oft auch Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) und Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Vermutlich ist die Wendung, die die für beide negativen Konsequenzen vermeintlicher Untreue so treffend beschreibt, aber schon älter. Ein gewisses Maß an Eifersucht ist sicherlich wichtig für eine Beziehung, zeigt sie doch Interesse am Partner. Aber: Die Dosis macht das Gift!
Eigen Fleisch und Blut...nennen wir gern mal unsere Kinder und wir stehen zu ihnen - egal, was sie gerade wieder angestellt haben. Die alttestamentarische Wendung geht auf Joseph zurück, der von seinen neidischen Brüdern in eine Grube geworfen und getötet werden soll. Als kurz darauf eine Karawane vorbeikommt, schlägt sein Bruder Juda vor: »Melius est ut vendatur Ismahelitis et manus nostræ non polluantur frater enim et caro nostra est adquieverunt fratres sermonibus eius« - »Kompt lasset vns jn den Jsmaeliten verkeuffen, das sich vnser hende nicht an jm vergreiffen, denn er ist vnser Bruder, vnser fleisch vnd blut. Vnd sie gehorchten jm« (1 Mose 37:27).
EigenbrötlerLange, bevor es den Bäcker als Berufstand gab, buken die Einwohner eines Dorfes ihr Brot in einem gemeinsamen Backofen. Wer an diesem gesellschaftlichen Ereignis nicht teilnahm, seinen eigenen Brotteig oder den eigenen Ofen nutzte, war ein »Eigenbrötler«.
Nach anderer Deutung liegt der Ursprung im spätmittelalterlichen Wort »einbrodig« mit der Bedeutung »sein eigenes Brot, seinen eigenen Herd haben«. So gab es im 16./17.Jahrhundert in Süddeutschland Bewohner in Hospitälern (damals eher Alten- und Pflegeheim denn Krankenhaus), die ihr »aigen Brod« aßen - auf eigene Kosten unterbracht waren. Sie hatten in der Regel die bessere Unterkunft, oft die eigenen Möbel, eigene Verpflegung und hielten sich von den Almosenempfängern fern. Später war damit ein Junggeselle gemeint, der selbständig seinen Haushalt führte. Da diese alleinlebenden Männer nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen, kamen sie in den Ruf des Einzelgängers und Sonderlings.
Bis heute sondert der »Eigenbrötler« sich ab, lebt eher zurückgezogen und abgeschottet als Individualist und legt wenig Wert auf die Meinung seines Umfeldes.
Eigenlob stinkt...Freundeslob hinkt, Fremdenlob klingt: »Sag nichts Gutes über dich selbst - man wird dir mißtrauen. Sag nichts Schlechtes über dich selbst. - man wird dich beim Wort nehmen« warnte der französische Dichter und Pastor Joseph Roux (1834-1905) wie so viele vor ihm vor übertriebener Selbstdarstellung. Das Hervorheben eigener Leistungen und Fähigkeiten war seit jeher verpönt: »Propria laus sordet« (Selbstlob ist schmutzig) lautete schon ein lateinisches Sprichwort.
Eile mit Weile...sagen wir, wenn jemand zwar mit der gebotenen Eile handeln, dabei aber nichts überstürzen soll. Diese sprichwörtliche Redensart geht wohl auf das lateinische »Festina lente« (Eile langsam) zurück, laut Gaius Suetonius Tranquillus (um 70-140) Kaiserbiographien »De vita Cæsarum« (Kapitel 25) ein häufiger Ausspruch des römischen Kaisers Augustus.
Einen ganz ähnlichen Ansatz hat die alte chinesische Weisheit: »Wenn Du es eilig hast, mache einen Umweg«.
Auch in William Shakespeares (1564-1616) Tragödie »Romeo & Julia« sagt der Protagonist: »O laß uns fort von hier! Ich bin in großer Eil!«, worauf der Franziskaner Lorenzo antwortet: »Wer hastig läuft, der fällt; drum eile nur mit Weil!«
Ein abgefeimter Bursche ...ist in allen Schlechtigkeiten erfahren: Der Ursprung liegt wohl im alten Wort »Feim« (Schaum). »Abgefeimt« meinte damals soviel wie »den Schaum abschöpfen«, also etwas wegnehmen, auch »abgeschäumt, von Schaum und Schmutz gesäubert«. Darüber läßt sich auch die Übertragung zum heutigen »wegnehmen, jemanden übervorteilen, austricksen« herstellen. Wir gebrauchen also das Bild vom »Abschaum der Menschheit«.
Ein alter Mann ist doch kein D-Zug...beschweren wir uns, wenn uns etwas viel zu schnell geht, wir allzu übertriebene Erwartungen bremsen wollen: Die Redensart kommt aus der Zeit, als ein D-Zug, der nicht an jedem Dorfbahnhof hielt, noch als besonders schnelles Fortbewegungsmittel galt. Solche Schnellzüge, bei denen die Abteile miteinander verbunden und durch einen seitlichen Durchgang erreichbar waren, hatte die Deutsche Reichsbahn seit 1851.
Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann...machte in einem der besten Film aller Zeiten »Der Pate« (The Godfather) Don Vito Corleone: Marlon Brando (1924-2004) wird in Francis Ford Coppolas Meisterwerk von seinem »Patenkind« Johnny Fontane (Al Martino), einem erfolglosen Schauspieler, um einen Gefallen gebeten: Er braucht für seine Karriere als Filmstar eine Rolle, die ihm jedoch verweigert wurde. Der Pate nimmt sich der Sache an und antwortet auf die Frage, wie er den Produzenten des Films umstimmen will, mit dem berühmt-berüchtigten Satz »I'm going to make him an offer he can't refuse«.
Ein Arbeiter ist seines Lohnes wertOffenbar wird hier für die gerechte Bezahlung einer Dienstleistung plädiert - eine Bibelweisheit, die heute doch arg aus der Mode zu sein scheint: »In eadem autem domo manete edentes et bibentes quæ apud illos sunt dignus enim est operarius mercede sua nolite transire de domo in domum«. - »Jn dem selbigen hause aber bleibet, esset vnd trincket, was sie haben. Denn ein Erbeiter ist seines Lohns werd. Jr solt nicht von einem hause zum andern gehen« heißt es in Lukas 10.7. Ähnlich formuliert es 1 Timotheus 5.18: »Dicit enim scriptura non infrenabis os bovi trituranti et dignus operarius mercede sua«. - »Denn es spricht die schrifft, Du solt nicht dem Ochsen das maul verbinden der da dreschet. Vnd ein Erbeiter ist seines Lohns wird«.
Ein As auf der Baßgeige...kennt sich mit allen Tricks aus, ist ein Teufelskerl - oder eben auch nicht. Wer so charakterisiert wird, sollte genau zuhören, denn diese Redewendung kann sowohl geringschätzend als auch anerkennend gemeint sein. Woher sie kommt, ist unbekannt. Das As könnte eine Verballhornung der Note As sein, sich aber auch auf die höchste Spielkarte beim Kartenspiel beziehen. Völlige Unklarheit herrscht bei der Frage, wie die Baßgeige – eine veraltete Bezeichnung für den Kontrabaß – ins Spiel kommt.
Ein As im Ärmel...hat, wer etwas in der Reserve, auf Lager, versteckt hält. Die Wendung kommt natürlich aus dem Kartenspiel, bei dem jemand ein As zurückhält, um es zu gegebener Zeit gewinnbringend ausspielen zu können.
Ein Auge auf jemanden haben...wir zum einen, wenn wir auf eine Person (sive: eine Sache) ganz besonders aufpassen, wachsam sind, jemanden mißtrauisch beobachten - zum anderen aber auch, wenn wir an einer bestimmten Person Gefallen finden. Wir haben ständig »ein Auge« auf ihm, beobachten, was er tut oder läßt.
Ein Auge auf jemanden werfen...wir, wenn wir Gefallen an jemandem finden, uns für ihn interessieren. Wir sehen ihn ständig an, können die Augen nicht abwenden. In der apokryphen »Geschichte von Susanna und Daniel« heißt es in der Bibel: »Vnd da sie die Eltesten sahen teglich darein gehen, wurden sie gegen jr entzünd mit böser lust vnd wurden drüber zu Narren vnd worffen die augen so gar auff sie Das sie nicht kondten gen Himel sehen vnd gedachten weder an Gottes wort noch straffe« (Daniel 1.8f).
Ein Auge für etwas haben...meint, das richtige Verständnis, das nötige Urteilsvermögen für etwas zu haben, mit einem Blick die jeweiligen Stärken und Schwächen, den Wert und bestimmte Eigenschaften zu erkennen.
Ein Auge riskieren...wir umgangssprachlich, wenn wir einen kurzen Blick auf etwas wagen, es vorsichtig anschauen, nur heimlich, verstohlen hinsehen: Mittelalterliche Ritter trugen bei ihren Turnieren Helme mit Visieren, die mit nur sehr kleinen, engen Sehschlitzen ausgestattet waren. Da dies sehr hinderlich war, wenn man seinen Gegner richtig anvisieren und mit den großen Lanzen genau zielen wollte, klappte manch Ritter das Visier hoch und »riskierte ein Auge«, da er seinem Gegner so eine sehr verletzliche Stelle preisgab und stets damit rechnen mußte, ein Auge ausgestochen zu bekommen.
Ein Auge zudrücken...heißt, nachsichtig zu sein, über bestimmte Dinge hinwegzusehen, ein Vergehen nicht oder nur milde zu bestrafen. Vermutlich kommt der Ausdruck aus dem Gerichtswesen: Durch bestimmte Zeichen konnte ein Richter aufgefordert werden, das eine oder andere zu »übersehen«. Nach den mittelalterlichen »Weistümern« - mündlich überlieferten Rechtssätzen vor allem im bäuerlichen Milieu - soll ein Richter, wollte er Gnade vor Recht ergehen lassen, dem Missetäter auch schon mal einen einäugigen Büttel auf einem einäugigen Pferd geschickt haben, um die Nachsicht des »Auges des Gesetzes« anzudeuten. Justitia, die personifizierte Gerechtigkeit, verhüllt gar gleich beide Augen mit einer Binde, um ohne Ansehen der Person und damit gerecht zu urteilen...
Ein Ausbund seinBedeutet heute, der Beste seiner Gattung zu sein (Ein Ausbund an Güte, Schönheit, Fröhlichkeit...). Ursprung ist wohl der alte Kaufmannsbrauch, von einer Ware das schönste, beste Stück, eben den Ausbund, oben auf das Bündel oder Paket zu binden, um die gute Qualität auch der anderen Stücke anzudeuten.
Ein Bild für die GötterDieser ungewöhnliche, oft lächerliche Anblick meint die griechischen Götter, die der Sage nach selbst für allerhand Kapriolen bekannt waren. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) nennt in seinem Singspiel »Erwin und Elmire« zwei Liebende ein »Schauspiel für die Götter«, da sie schöner anzusehen seien, als das herrlichste Frühlingswetter.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...ist eine Metapher dafür, daß komplizierte Sachverhalte mit einem Bild oft besser erklärt werden können, als mit einem umfangreichen Text. Dieser Ausspruch taucht erstmals 1911 als Richtlinie des amerikanisches Verlegers Tess Flanders auf: »Use a picture. It's worth a thousend words«. Am 8. Dezember 1921 veröffentlichte der Werbefachmann Fred R. Barnard in der Zeitschrift »Printers' Ink« eine Anzeige mit dem ganz ähnlichen Slogan »One Look is Worth A Thousand Words« (Ein Blick ist 1000 Worte wert). Am 10. März 1927 erschien eine zweite Anzeige mit der Phrase »One Picture is Worth Ten Thousand Words« (Ein Bild ist 10000 Worte wert) und behauptete, damit die Leute es ernstnehmen, es handele sich dabei um ein chinesisches Sprichwort. Bald darauf wurde der Satz auch tatsächlich dem chinesischen Philosophen Konfuzius zugeschrieben...
Ein braves Pferd stirbt in den Sielen...sagen wir, um auszudrücken, daß wir einst »bis zuletzt arbeitend, mitten in der Arbeit« sterben würden, so wie ein tüchtiges Pferd eher im Geschirr sterben würde, als vorher aufzugeben. In einer Rede vor dem preußischen Abgeordnetenhaus am 4. März 1881 wies der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-98) Forderungen nach seinem Rücktritt mit diesen Worten zurück.
Ein Brett vor dem Kopf habenDas Synonym für »begriffsstutzig, töricht, verbohrt« stammt wohl aus der Viehwirtschaft: Anno 1699 schreibt Christian Lehmann (1611-88) in »Historischer Schauplatz derer natürlichen Merkwürdigkeiten in dem Meißnischen Ober-Ertzgebirge«: »Störrische Ochsen werden mit einem vor die Augen hangenden Brettlein geblendet. Mit dem Brett ist auch das Joch der Ochsen gemeint, die gemeinhin als dumm gelten und von denen man meinte, ihre Denkfähigkeit werde durch das Brett beeinträchtigt«. Die Verbindung (dummer) Ochse und »Brett vor dem Kopf« läßt leicht die Übertragung auf einen dummen, engstirnigen Zeitgenossen nachvollziehen. Allerdings gab es im Mittelalter auch Handwerker, die sich freiwillig ein Brett vor den Kopf setzten: Steinmetze oder Schmiede beispielsweise, die sich für bestimmte Arbeiten, bei denen besonders die Augen und das Gesicht gefährdet waren, mit einem Brett schützten, das nur schmale Sehschlitze hatte.
Ein Buch aufschlagenIn der Frühzeit des Buchdrucks lieferte der Drucker nur den Buchblock, der dann, um das wertvolle Werk zu schützen, zwischen zwei Deckel eingebunden wurde. Die Deckel, oft aus Buchenholz, wurden mit einem breiten Metallhaken zusammengehalten. Man legte das Buch auf den Tisch, drückte auf den Deckel und klappte den Haken beiseite. Schlug man aber einfach auf den Deckel, sprang der Bügel meist von allein auf, deshalb »schlägt« man noch heute Bücher auf.
Das »Buch« selbst hat seinen Namen übrigens vom althochdeutschen »buoh«, das ursprünglich die Runenzeichen benannte, die in Buchenstäbe (daher auch »Buchstabe«) geschnitzt wurden. Im Jahre 1382 entstand dann in Nürnberg Deutschlands erste Papiermühle, wo Papier aus Lumpen von benutztem Leinen gepreßt wurde, um das teure Pergament zu ersetzen.
Ein dickes Fell habenViele Tiere fressen sich, um den Winterschlaf zu überstehen, beizeiten ein ordentliches Fettpolster an. Auch das Fell wird erheblich dicker und dichter. Dadurch erscheinen die Bewegungen des satten und zufriedenen Tieres stark verlangsamt.
Ein Ding aus dem Tollhaus...ist für uns unvorstellbar: »Tollhäuser« sind die Vorläufer unserer psychiatrischen Einrichtungen, »toll« waren die »Verrückten«. Zur »Ruhigstellung« unbändiger Patienten wurden sogenannte »Tollkisten« verwendet, in die ein Patient eingesperrt wurde. Bei Christian Wernicke (1661-1725) findet sich in »Crispina und Hirpinus« (um 1697) dazu: »...Crispina schwert, Hirpinus schwert, Biss in das Spinnhaus sie, er in das Tollhaus fährt...«
Ein Donnerwetter zu hören kriegen...Kinder oder Ehemänner, die vom wahren Familienoberhaupt wegen möglicher Vergehen lautstark ausgeschimpft und zurechtgewiesen werden. Dabei kann die Gute tatsächlich manchmal die Urgewalt und die Lautstärke eines kräftigen Gewitters erreichen. Nichts für ängstliche Naturen...
Ein Dorn im AugeEtwas Unerträgliches - eine Person, einen Zustand, einen sonstigen Schandfleck - beschreiben wir nach einem Bibelwort: »Sin autem nolueritis interficere habitatores terræ qui remanserint erunt vobis quasi clavi in oculis et lanceæ in lateribus et adversabuntur vobis in terra habitationis vestræ«. - »Werdet jr aber die Einwoner des Lands nicht vertreiben fur ewrem angesicht, So werden euch die so jr vberbleiben lasst zu dornen werden in ewren augen vnd zu stachel in ewrn seiten vnd werden euch drengen auff dem Lande, da jr innen wonet«. (Numeri 33.55)
Ein ehrlicher Makler...nannte sich einst der »Eiserne Kanzler« Otto Eduard Leopold Graf von Bismarck-Schönhausen (1815-98) selbst, als er auf dem Berliner Kongreß (13. Juni - 13. Juli 1878) zwischen Vertretern des Deutschen Reiches, Rußlands, Österreich-Ungarns, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und des Osmanischen Reiches zu vermitteln suchte. Er meinte, seine Rolle sei »die eines ehrlichen Vermittlers, der das Geschäft wirklich zustandebringen will«.
Ein Eigentor schießen...sich Leute, die einen unbedachten Schritt tun und sich so unabsichtlich selbst in eine schwierige Lage bringen, oder die eigentlich anderen schaden wollten und nun selbst das Nachsehen haben. Die Redensart kommt natürlich aus dem Ballsport, wo manchmal ein Spieler den Ball versehentlich in das Tor der eigenen Mannschaft - statt wie eigentlich üblich der gegnerischen - schießt.
Ein Faible für etwas habenWir haben eine Schwäche für irgendwas, ein besonderes Interesse daran: Der französische Ausdruck »Faiblesse, faible« bedeutet auf gut Deutsch ganz einfach »Schwäche, schwach«.
Ein Fanal setzenDas »Fanal« (ital. »fanale« - Leuchte, Fackel) für ein besonderes Ereignis, ein Leuchtfeuer, kam im 18./19. Jahrhundert nach Deutschland. Mit vereinbarten Rauch- und Flammenzeichen übermittelte man bereits im Altertum bei den Persern, Griechen und Römern, aber auch noch im Mittelalter bestimmte Nachrichten über kurze Entfernungen. Heute gebrauchen wir die Redensart als Zeichen für den Aufbruch zu etwas Neuem. Der Begriff läßt sich auch geographisch einordnen: Im alten Konstantinopel heißt ein Stadtteil in der Hafengegend nach dem dort stehenden Leuchtturm so.
Ein Feigenblatt umhängenHier wird wiedermal auf die Zeit im Paradies Bezug genommen. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis genascht hatten, erkannten sie, daß sie unbekleidet waren und bedeckten ihre Blöße vorerst mit einem Feigenblatt: »Et aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent esse se nudos consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomata«. - »Da wurden jr beider Augen auffgethan vnd wurden gewar, das sie nacket waren Vnd flochten Feigenbletter zusamen vnd machten jnen Schürtze«. (Genesis 3.7)
Ein flaues Gefühl in der Magengegend...haben wir gelegentlich, wenn uns etwas bedrückt, eine Intuition uns unbewußt Übelkeit bereitet oder etwas unangenehm ist. Ursache dieser »Nausea« können eine Vielzahl psychischer Einflüsse wie Kummer, Angst oder Erregung sein, die uns »auf den Magen schlagen«.
Ein Galgen voll...sind sieben Personen - so viele sollen am Standardgalgen gemächlich hängen können: Zwei arme Sünder trug jeder der drei Querbalken der triangelförmig stehenden drei Pfeiler, während sich in der Mitte an einem höher angebrachten Gebälk der siebte und »Ehrenplatz« für den »Erzdieb«, welcher als ein solcher zum »höchsten Galgen« kondemniert war, befand.
Ein gebranntes Kind scheut das FeuerIn einer längst vergangenen Zeit, als die Menschen noch in der Lage waren, schlechte Erfahrungen strategisch richtig in künftige Entscheidungen einfließen zu lassen, lernten sie, Situationen zu meiden, die zu Verletzungen führen. Eine Verbrennung ist so eine äußerst schmerzhafte und damit lehrreiche und prägende Verletzung, die sich für immer in unser Gedächtnis »einbrennt«. Niemand wird ein zweites Mal eine heiße Herdplatte anfassen. Übertragen gilt dasselbe, wenn man eine herbe Enttäuschung erlebt hat - man wird vorsichtiger, damit das nicht wieder passiert.
Schon der Schriftsteller Jakob Eyrer (1544-1605), schrieb in einem seiner Dramen: »Ein sprichwort sagen thut: verbrents kind fürcht dess feuers glut«. Auch Johann Wolfgang von Goethe verwendete die Redensart in abgewandelter Form: »Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, ein oft versengter Greis scheut, sich zu wärmen.«
Ein Gedächtnis wie ein Elefant...haben umgangssprachlich Leute mit einem außergewöhnlich guten Erinnerungsvermögen. Dieser Vergleich geht davon aus, daß sich Elefanten angeblich noch nach Jahren daran entsinnen sollen, wer ihnen einst etwas Böses angetan hat. Sein ausgezeichnetes Gedächtnis hat der Dickhäuter eigentlich, weil er auf Wanderungen oft über mehrere tausend Kilometer genau wissen muß, wo sich Wasser- und Futterplätze befinden.
Ein Gedächtnis wie ein Sieb...haben manche Menschen, die sich zwar Personen, aber nicht die passenden Namen dazu merken können. Was wie ein Makel klingt, ist in Wirklichkeit eine biologische Notwendigkeit: Das menschliche Gehirn filtert unwichtige Informationen »wie ein Sieb« permanent heraus, um Altes durch Neues ersetzen zu können. Eine zentrale Aufgabe kommt hier dem Schlaf zu, wo während der Traumphasen unnütze Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen wieder gelöst werden.
Ein gefundenes Fressen...ist wohl immer willkommen - erspart es einem doch die oft mühevolle Suche danach oder die Arbeit dafür. Der Volksmund drückt mit dieser Wendung allgemein aus, daß jemandem etwas »in den Schoß fällt«, sehr gelegen kommt, weil er es ohne viel Aufwand für sich nutzen kann. Die Wendung taucht erstmals bei dem Barockdichter Andreas Gryphius (1616-64) auf, der in wortgewaltigen Sonetten die Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs beschrieb.
Ein gerüttelt Maß...an »Irgendwas« drückt umgangssprachlich »sehr viel, genügend, in vollem Umfang« aus: Ein »gerüttelt Maß« (von ahdt. »maza« - Zu- oder Angemessenes) ist der Inhalt eines Meßbechers, der nach dem ersten Füllen durchgerüttelt wurde, damit das vorhandene Schüttgut sich »setzt« und so verdichtet keine Luftlöcher mehr hat, Platz für mehr freigibt.
Die Redensart geht auf das Lukasevangelium zurück - Jesus sagt in einer Predigt auf dem Felde: »Date et dabitur vobis mensuram bonam confersam et coagitatam et supereffluentem dabunt in sinum vestrum eadem quippe mensura qua mensi fueritis remetietur vobis« - »Gebt, so wird euch gegeben. Ein vol, getrueckt, geruettelt vnd vberfluessig Mas, wird man in ewern schos geben. Denn eben mit dem Mas, da jr mit messet, wird man euch wider messen«. (Lukas 6.38)
Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper»Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. (Man muß darum beten, daß ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohne)« hoffte dereinst der römische Satirendichter Decimus Iunius Iuvenalis (um 65-128). Baruch Benedictus de Spinoza (1632-77) formulierte es in seinem Werk »Über die Macht des Verstandes oder die menschliche Freiheit« ähnlich: »Id felicitati tribuitur, quod totum vitæ spatium mente sana in corpore sano percurrere potuerimus. (Es wird dem glücklichen Gemüte zugesprochen, wenn wir die ganze Lebenszeit mit gesundem Geist in einem gesunden Körper durchlaufen können.)«
Ein Gläschen in Ehren darf niemand verwehren...behauptet ein alter Trinkspruch. Bei festlichen Anlässen anzustoßen, ist nicht erst heute fixer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens - schon Martin Luther (1483-1546) soll sich incognito als »Junker Jörg« mit dem Spruch »Wer will uns verwehren, ein Gläschen in Ehren, und ganz unter uns« auf der Wartburg bei Eisenach verewigt haben.
Ein guter Hahn wird selten fett...sagt eine uralte Volksweisheit. Ein guter Hahn, der ganz allein einer ganzen Schar Hennen vorsteht und sie alle regelmäßig besteigt, hat »alle Hände voll zu tun«. Das läßt ihm naturgemäß nur wenig Zeit für die Futtersuche, er hat gar keine Zeit, fett zu werden und verbraucht darüber hinaus jede Menge Kalorien.
Johann Jakob Heinrich Bücking (1749–1838) erwähnt das Sprichwort im Jahr 1797 in seinem Werk »Medicinische und physikalische Erklärung deutscher Sprichwörter«. Er schreibt dazu: »Man nennt hier den Hahn nur in dem Verstande gut, da er, als Mann seiner Weiber, seiner Pflicht genug thut. Und appliciert es auf den Mann im menschlichen Geschlechte, und nicht ohne Grund.«
Ein Haar in der Suppe...findet jemand, der nur das Schlechte sieht, immer den Nachteil oder Haken bei etwas sucht, an allem etwas auszusetzen hat: Diese pessimistische Grundeinstellung kommt ursprünglich aus der Gastronomie: Haare gelten zwar gemeinhin als schön und als Symbol für Jugend und Vitalität - einmal ausgefallen jedoch wandelt sich das Verhältnis rapide und sie werden unheimlich, geradezu ekelerregend und haben ausgerechnet im Essen natürlich gleich gar nichts zu suchen. Wer also das sprichwörtliche »Haar in der Suppe« sucht, hofft bildlich, etwas Negatives an jemandem zu finden - allerdings wußte schon der Dramatiker Christian Friedrich Hebbel (1813-63) in seinen »Neuen Epigrammen« zu berichten: »Mancher findet nur darum ein Haar in der Suppe, weil er das eigene Haupt schüttelt, solange er ißt«. Schon in Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens (1622-76) Schelmenroman »Simplicissimus« von 1668 heißt es: »Weil er auch in einem Ei ein Haar finden könne, solle er sagen, woran es dieser Tafel mangele«.
Ein Heimspiel habenDie Erfolgsaussichten der Heimmannschaft liegen mit etwa 50% statistisch gesehen weitaus höher, als die der Gäste. Die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, liegt demgegenüber nur bei rund 20%. Gründe dafür sind sowohl die gewohnte Umgebung, wie auch das archaische Revierverhalten der Spieler und natürlich die Unterstützung durch das heimische Publikum.
Ein heißes Eisen anfassen...war ein Rechtsbrauch des 12. Jahrhunderts, der nach einem genau festgelegten kirchlichen Ritual ablief: Der Beweispflichtige mußte bei der »Eisenprobe« ein glühendes Eisenstück mit bloßer Hand tragen. Blieb die Hand unverletzt oder verheilten die Wunden schnell, war der geforderte Unschuldsbeweis dieses Gottesurteils erbracht.
Ein Herz und eine Seele...sind zwei Menschen, die sich sehr mögen, nachgerade eine Seelenverwandtschaft verspüren. Die Apostelgeschichte des Lukas aus dem Neuen Testament der Bibel beschreibt den Werdegang der Jünger nach Jesu Tod, über die geistige und materielle Gütergemeinschaft der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem heißt es: »Multitudinis autem credentium erat cor et anima una nec quisquam eorum quæ possidebant aliquid suum esse dicebat sed erant illis omnia communia« - »Der menge aber der Gleubigen war ein hertz vnd eine seele. Auch keiner sagete von seinen Guetern, das sie sein weren, sondern es war jnen alles gemein«. (Apg. 4:32)
Ein Hintertürchen offenlassen...heißt heutzutage, daß wir zu etwas keine feste Zusage machen, uns eine weitere Möglichkeit offenhalten. Früher hatten viele Häuser einen zweiten Ausgang zum Hof oder Stall, Schlösser, Burgen oder Stadtwohnungen meist auch einen Dienstboteneingang und man hielt sich tatsächlich dieses »Hintertürchen« offen, durch das man bei Gefahr entweichen konnte. Nicht selten war es besser, bei einer Belagerung oder beim Anrücken des Feindes sein Heil in der Flucht zu suchen und so wenigstens noch die nackte Haut zu retten.
Ein hohes Tier...sagte man im 18. Jahrhundert geringschätzig über Menschen, die äußerlich vornehm wirken wollten, aber ihre »unzivilisierte, tierische Stufe« nicht überwunden hatten. Diese negative Bedeutung hat sich allerdings im Laufe der Zeit verflüchtigt, heute ist ein »hohes Tier« allgemein ein zu Ansehen gekommener Mensch.
Ein Huhn, das goldene Eier legt, schlachten...hin und wieder Leute, die sich - töricht oder unvorsichtig wie sie halt sind - selbst die Grundlage ihres Wohlstandes entziehen, eine wichtige Einnahmequelle versiegen lassen und in ihrer schier grenzenlosen Gier eigentlich sichere wirtschaftliche Vorteile verspielen. Diese Wendung bezieht sich auf die Fabel »La poule aux œufs d'or« - »Das Huhn mit den goldenen Eiern« - des französischen Schriftstellers und Dichters Jean de la Fontaine (1621-1695):
»Wer alles haben will, verliert oft alles!
Dies zu erklären, denk ich jenes Falles,
In dem ein Huhn, wie uns die Fabel lehrt,
Dem Geizhals, dem es zugehört,
Von Tag zu Tag ein goldnes Ei beschert.
Er meint, es habe einen Schatz im Bauch;
Er tötet's, öffnet's, findet trüben Mutes:
Die Henne war genau wie andre Hennen auch.
Und so beraubte er sich selbst des größten Gutes.
Ein Beispiel, das sich alle merken sollten!
Wie viele gibt es doch von solchem Schlag,
Die arm geworden sind an einem Tag,
Weil sie in einem Tag zu Reichtum kommen wollten«.
Ein Hühnchen rupfen...wir umgangssprachlich manchmal mit jemandem, den wir uns vorknöpfen, weil wir verärgert sind und eine Sache klarstellen wollen: Einst, als die Suppenhühner noch nicht fertig vorbereitet in der Tiefkühltruhe wohnten, mußten sie recht aufwendig gerupft, jede einzelne Feder entfernt werden, bevor sie in den Kochtopf gesteckt werden konnten. Diese Arbeit war zwar eigentlich ganz einfach, allerdings sehr zeitraubend, also nutzte man sie für ausführliche Unterhaltungen und klärende Diskussionen oder Streitgespräche - dabei »fliegen die Federn«.
Ein Indianer kennt keinen Schmerz...behauptet ein gängiges Sprichwort, das wohl jeder von uns als Kind dann und wann zu hören bekam, wenn mal wieder das Knie aufgeschlagen war. Eine mögliche Ursache für diese - eigentlich unhaltbare - Annahme könnte im indianischen »Sonnentanz« liegen, einer Zeremonie, bei der in Trance Selbstverletzungen vorgenommen wurden. Ähnliche Riten der Schmerzausschaltung sind in vielen Kulturen bekannt - Rückschlüsse auf den sprichwörtlich schmerzfreien Heldenmut der amerikanischen Ureinwohner lassen sich jedoch nicht ziehen. Diese nur im deutschsprachigen Raum geläufige Redewendung geht denn wohl auch eher wohl auf Karl May (1842-1912) und seinen »Schatz im Silbersee« zurück: »Ein Indianer wird von frühester Kindheit an in dem Ertragen körperlicher Schmerzen geübt. Er gelangt dadurch so weit, daß er die größten Qualen ertragen kann, ohne mit der Wimper zu zucken«.
Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge...weiß wohl jeder, der Kinder hat: Erfüllt man ihnen einen Herzenswunsch, hat man doch nur einen kurzen Moment lang Ruhe, bis schnell ein neues Ziel der Begehrlichkeit gefunden ist. Diese Lebensweisheit beschrieb einst in seinem Gedicht »Niemals« schon Wilhelm Busch (1832-1908):
»Du triumphierst und jubelst laut:
Jetzt hab ich endlich Frieden!
Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
Bezähme deine Zunge!
Ein jeder Wunsch wenn er erfüllt,
Kriegt augenblicklich Junge«.
Ein Kavalier genießt und schweigt...sagen wir mit einem Augenzwinkern, wenn wir über »gewisse Dinge« nicht ausführlicher berichten wollen. Ein taktvoller Mann, ein »Kavalier der alten Schule«, redet halt nicht über seine Liebesabenteuer, um die »Dame seines Herzens« nicht zu kompromittieren. In diesem Sinne verwendet den Ausdruck auch Erich Maria Remarque (1898-1970) in seinem autobiographisch gefärbten Roman »Der schwarze Obelisk - Geschichte einer verspäteten Jugend«: Nach einer vorgetragenen Anekdote wird Sargtischler Wilke gefragt: »Er (der Sarg) wurde zur Liebeslaube?«, worauf der entgegnet: »Der Kavalier genießt und schweigt«.
Ein kleiner Teufel...ist ein Synonym für freche Kinder, die böse Streiche spielen. Aber keine Sorge: »Kleine Teufel« stehen in der Hierarchie des Hades auf einer der untersten Stufen und werden als eher harmlos eingestuft.
Ein Königreich für ein Pferd...bietet William Shakespeares (1564-1616) »Richard III«. in dem gleichnamigen Drama von 1593, als er geschlagen über das Schlachtfeld irrt. Das Angebot bleibt unerhört. Des Tyrannen Truppen werden in die Flucht geschlagen, Richards stolzes Roß getötet: »A Horse! A Horse! My kingdom for a horse« (Ein Pferd, ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd) ruft er im 5. Akt, 4. Szene verzweifelt über das Schlachtfeld, bekundet, schon fünf als Richmond Verkleidete getötet zu haben. Der echte Herzog aber erschlägt Richard. Damit ist der Krieg der Häuser Lancaster und York beendet. Heute verwenden wir das berühmte Zitat scherzhaft, wenn uns ein langer Fußmarsch bevorsteht.
Ein kräftiger Schluck aus der Pulle...steht oft bildlich für ein relativ gutes Ergebnis, das man bei Verhandlungen erzielt. Die »Pulle« - im norddeutschen Raum eine Flasche - geht auf das lateinische »ampulla« zurück; der »kräftige Schluck« hängt wohl damit zusammen, daß ein Dürstender auf den lästigen Umweg über das Glas eher verzichtet.
Ein Küßchen in Ehren kann keiner verwehren...sagt ein Sprichwort aus dem 17. Jahrhundert und bis heute ist es üblich, sich zu umarmen und - in manchen Gegenden gar mehrmals - auf die Wange zu küssen, wenn man alte Freunde trifft. Das mittelalterliche Original besagt ursprünglich, daß ein Kuß - aus edler Absicht, Hochachtung, Freundschaft und mit Bewilligung gegeben - nicht als Beleidigung zu ahnden sei. Hingegen wurde nach römischem und deutschem Recht streng bestraft, wer eine Ehe- oder besonders eine Jungfrau wider deren Willen aus Falschheit, Bosheit, Verräterei oder verbotener Wollust küßte.
Diese Moralbegriffe unserer Altvordern inspirierten wohl auch Albert Lortzing (1801-51) zu seiner komischen Oper »Der Waffenschmied« - hier läßt sich Fräulein Irmentraud, die Erzieherin von Marie, der Tochter des Protagonisten, von dem verkleideten Grafen Konrad von Liebenau becircen und antwortet auf seine Respektbezeugung: »Das läßt sich hören, denn einen Kuß in Ehren kann niemand wehren. Also da: Küß Er mir die Hand«. (2. Akt, 2. Auftritt)
Auch in Theodor Fontanes (1819-98) Roman »Unterm Birnbaum« heißt es: »Hradscheck, voll Beherrschung über sich selbst, ging in den Laden, der gerade voll hübscher Bauernmädchen war, und zupfte hier der einen am Busentuch, während er der andern die Schürzenbänder aufband. Einer Alten aber gab er einen Kuß. ›Einen Kuß in Ehren darf niemand wehren - nich wahr, Mutter Schickedanz?‹«
Ein leerer Sack steht nicht aufrechtWer arbeiten soll, muß auch essen. Wer hungrig ist, wäre dazu nicht in der Lage.
Ein Lied davon singen...können Menschen, die über etwas aus eigener (oft unangenehmer) Erfahrung berichten, etwas, das sich so tief in ihre Erinnerung eingebrannt hat, daß es - wie der Refrain eines Liedes - immer wiederkehrt. Die Wendung geht wohl darauf zurück, daß schon früh Lieder genutzt wurden, um wichtige Ereignisse anderen mitzuteilen und sie zu überliefern: Ein Lied war ursprünglich eher eine Art Vortrag, bei dem durchaus auch Faktenwissen vermittelt wurde - das »Nibelungenlied« beispielsweise war kein Lied im heutigen Sinne, sondern das »Nibelungenepos«. Wer ein Geschehen selbst erlebt hatte, konnte am besten »ein Lied davon singen«.
Ein Loch in den Bauch fragen...uns manchmal sehr mitteilsame Zeitgenossen, vor allem aber Kinder, die ihren ungeheuren Wissensdurst auch noch bis ins letzte Detail gestillt zu wissen wünschen. Versucht man, eine Frage zu beantworten, folgen unweigerlich mehrere neue. Ein Ende ist nicht abzusehen - als hätte man ein Faß angestochen, aus dem die Neugier nun unentwegt sprudelt. In der Überlieferung findet sich bei Christian Lehmann (1611-88) die Erklärung »heftig oder ausdauernd auf jemanden einreden« und den Hinweis »Wenn man ein Loch durch manchen predigt, so hilft's doch nicht«. In Thomas Murners (1475-1537) »Schelmenzunft« aus dem Jahre 1512 lesen wir: »Eyn loch durch brieff reden«, dabei ist ein Jurist mit derbem Mund abgebildet, der auf einen durchlöcherten Brief in seinen Händen gerichtet ist.
Ein Machtwort sprechen...wollte Martin Luther (1483-1546), der über einen Aspekt der Schöpfungsgeschichte sagte: »Da er (Gott) sprach, es sein Sonn und Mond, und war kein Lügenwort, so ist sein Wort freilich nicht ein Nachwort, sondern ein Machtwort, das da schaffet, was es lautet«.
Ein Mann muß tun, was ein Mann tun mußEr sollte gradlinig, selbstbewußt und ehrlich seinen Weg gehen, klare Ziele haben, Widerstände überwinden und sich durch nichts und niemanden davon abbringen lassen.
Die Wendung »A man's got to do what a man's got to do« benutzte vermutlich zuerst John Wayne (1907-79) in John Fords Western »Ringo« (orig. »Stagecoach«, 1939), einem der bedeutendsten Klassiker der amerikanischen Filmgeschichte, der von einer gefährlichen Postkutschenfahrt durchs Apachenland erzählt; wurde aber auch durch zahlreiche andere Filme zum geflügelten Wort.
Ein Mann wie ein Baum...steht sinnbildlich für die Standhaftigkeit und Unbeugsamkeit eines Menschen: Ein starker Mann wird hier mit einem starken Baum verglichen, den sprichwörtlich auch »nichts umhauen«, den kein Sturm fällen kann.
Ein Mann, ein Wort...sagen wir, um zu bekräftigen, daß wir zu einer einmal getroffenen Entscheidung bedingungslos stehen. Ursprünglich thematisiert Friedrich Schiller (1759-1805) anno 1795 in seinem Gedicht »Pegasus im Joche« mit dem geflügelten Musenroß »Hippogryph«, auf dem sich Dichter in höchster Begeisterung emporschwingen, die unüberbrückbare Kluft zwischen dem freien Leben der Poesie und den Anforderungen des schnöden Arbeitslebens:
»Die Flügel zwar, spricht er, die schaffen keinen Nutzen;
Doch die kann man ja binden oder stutzen,
Dann ist das Pferd zum Ziehen immer gut.
Ein zwanzig Pfund, die will ich wohl dran wagen.
Der Täuscher, hochvergnügt, die Waare loszuschlagen,
Schlägt hurtig ein. »Ein Mann, ein Wort!«
Und Hans trabt frisch mit seiner Beute fort«.
Ein Mann, ein Wort - eine Frau, ein Wörterbuch...sagt nicht ganz umsonst der Volksmund. Auch wenn unzählige Studien uns (je nach Gutdünken des jeweiligen Auftraggebers) »wissenschaftlich beweisen« wollen, daß dies genau so sei oder eben gerade nicht, daß die geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen redseligen und schweigsamen Menschen wahlweise sehr gering oder ganz gewaltig seien: Mit der ursprünglichen Bedeutung der Redensart »Was gesagt ist, das gilt« hat das alles nicht das Geringste zu tun. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man sich in Erinnerung ruft, daß das »Wort« für ein »Versprechen« steht, für alte Tugenden wie Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. Man tut, was man sagt. Es geht hier auch weder darum, das letzte Wort zu behalten, noch um das feministisch so gern kritisierte Bibelwort »Mulieres in ecclesiis taceant non enim permittitur eis loqui sed subditas esse sicut et lex dicit« - »Ewer Weiber lasset schweigen vnter der Gemeine, Denn es sol jnen nicht zugelassen werden, das sie predigen, sondern vnterthan sein, Wie auch das Gesetz sagt« (1 Korinther 14.34).
Ein Mäntelchen umhängenNach den Rechtsvorschriften des Sachsenspiegels (um 1230), des bedeutendsten Rechtsbuches des deutschen Mittelalters, konnten uneheliche Kinder nachträglich dadurch legitimiert werden, daß sie während der Trauung unter dem Mantel der Braut getragen wurden. Sie wurden dadurch ehelichen Kindern gleichgestellt.
Ein Nickerchen machen...wir viel zu selten - dabei weiß doch eigentlich jeder, wie leistungsfördernd der kurze Schlaf in der Mittagspause ist. Der Ausdruck leitet sich vom »Einnicken«, dem Wegknicken des Kopfes beim Einschlafen im Sitzen ab. Die Muskelspannung läßt schlagartig nach und der Kopf fällt nach vorn, als ob wir »Nicken«.
Ein P davorsetzenIm Mittelalter wurden Häuser, in denen ein Bewohner an Pest oder Pocken erkrankt war, mit einem großen »P« an der Hauswand oder Tür gekennzeichnet. Außerdem gab es Sinnsprüche an den Häusern, die besonders auf die Abwehr dieser beiden Krankheiten abzielen sollten.
Ein Paar Hosen...meint ursprünglich die einzelnen Beinlinge, die an einer Art Strapsen an der Unterhose befestigt wurden. Auch wenn es sich heute zumeist nur noch um eine einzige Hose handelt, hat sich das »Paar Hosen« erhalten.
Ein paar KrötenDas Synonym für »wenig Geld« hat mit den kleinen Hüpfern gar nichts zu tun. Im Niederdeutschen hieß eine kleine, wenig kaufkräftige Münzeinheit »Groschen« oder »Groten«. Im Volksmund wurden daraus folglich die »Gröten« oder später »Kröten«, die diese Redensart erklären.
Ein Quentchen Glück...ist oft genau das, was man gerade braucht. Das »Quentchen«, ein altes Gewicht, der fünfte Teil eines Lots, kommt vom mittellateinischen »quentinus«, was auf »quinque« (Fünf) zurückgeht. Ursprünglich bezeichnete ein »Quint« den Fünftel-Solidus oder 1/100 des karolingischen Pfunds. Die Gewichtseinheit »Kölnische Mark« (in Gebrauch von 1524-1857) wurde in 16 Lot zu 4 Quentchen eingeteilt. 1 Quentchen entsprach demnach einem Gewicht von 3,654 Gramm.
Die uns in den 1990ern per milliardenschwerer »Rechtschreibreform« oktroyierte Neuschreibe »Quäntchen« behauptete fälschlich, das »Quentchen« stamme vom »Quantum« (wie viel, wie groß) ab. Dank eines »Quentchens Glück« konnte sich dieser Unsinn aber nicht durchsetzen.
Ein rotes Tuch...für jemanden ist eine Sache, die ihn sehr ärgert, provoziert, wütend macht. Das Wort geht auf den Stierkampf zurück, bei dem der Stier mit der »Muleta« - einem dunkelroten Tuch - gereizt wird. Übrigens ist es gar nicht die Farbe, die das Rindvieh aggressiv macht - der ist nämlich farbenblind -, sondern einzig die schnellen Bewegungen des Tuchs.
Ein ruhender Pol...ist ein Mensch, der sich selbst durch nichts aus der Ruhe bringen läßt, der bei jeder Aufregung die Übersicht behält, selbst Ruhe ausstrahlt und so ein wichtiger Orientierungspunkt für andere sein kann. Schon Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) beschreibt 1795 in seiner Elegie »Der Spaziergang« die Gegensätzlichkeit von Natur und Kultur, veranschaulicht durch die wechselnden Bilder eines Spaziergangs die Suche nach einem innerlichen Ruhepunkt: »Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht«.
Ein Schatten seiner selbst...ist jemand, der - anders als gewohnt - sehr blaß und krank aussieht, angeschlagen, in einem bedauernswerten körperlichen oder seelischen Zustand ist.
Die Wendung stammt leicht abgewandelt aus dem unvollendeten Epos »Pharsalia« (auch »Bellum Civile«) des römischen Dichters Marcus Annæus Lucanus (39-65), in dem er den römischen Bürgerkrieg zwischen Cæsar und Pompeius beschreibt. Nachdem Pompeius vom römischen Kaiser besiegt war, war er nur noch der »magni nominis umbra« - »Schatten eines großen Namens«.
Ein Schelm, der Arges dabei denkt...sagen wir oft, um eine peinliche Situation zu entkräften oder wenn Anstoß an etwas genommen wird, das allein für den Kommentierenden anstößig ist. Das Original »Honi soit qui mal y pense« (wörtlich: Schande über den, der schlecht darüber denkt) ist die französische Aufschrift auf dem englischen Hosenbandorden und auf dem Wappen des Vereinigten Königreichs. Als Urheber der Sentenz gilt der der Legende nach der Gründer des Hosenbandordens, König Edward III. von England (1312-77), als er zum Gaudium der Anwesenden das Strumpfband aufhob, welches seine Geliebte, Lady Catherine Grandison (1304-49), Countess of Salisbury beim Tanz verloren hatte.
Ein Schnippchen schlagen ...wir jemandem, wenn wir ihn hereingelegt haben, sein Vorhaben vereiteln konnten: »Schnipp« steht für die schnelle Bewegung einer Schere, seit dem Mittelalter auch für den Schnalzer mit dem Daumen und Mittelfinger als Ausdruck von Verachtung und gutmütig-hämischer Schadenfreude. Ein Beispiel ist bis heute das Schnipsen nach dem Kellner in der Kneipe.
Ein schönes Gesicht braucht Platz...sprach der Glatzkopf, als er auf seine schwindende Haarpracht angesprochen wurde.
Ein Schwarzes Schaf sein»Schwarze Schafe« fallen innerhalb einer Gemeinschaft auf, weil sie von der Norm abweichen und werden daher oft als Außenseiter betrachtet. Schwarze Wolle ist - anders als weiße, die sich beliebig einfärben läßt - kaum gefragt. Deshalb waren schwarze Schafe noch nie besonders populär und der Ausdruck läßt sich schon auf das erste Buch Mose zurückführen. Jakob verhandelt mit Laban über den Lohn, den er erhalten soll: »Gyra omnes greges tuos et separa cunctas oves varias et sparso vellere et quodcumque furvum et maculosum variumque fuerit tam in ovibus quam in capris erit merces mea«. - »Ich wil heute durch alle deine Herde gehen vnd aussondern alle fleckete vnd bundte schafe vnd alle schwartze schafe vnter den lemmern vnd die bundten vnd flecketen ziegen. Was nu bund vnd flecket fallen wird, das sol mein Lohn sein«. (Genesis 30.32)
Ein Stich ins WespennestWer etwas Heikles anspricht, kann damit einige Unruhe oder sogar Empörung verursachen, es entsteht ein Aufruhr - wie bei einem Stich ins Wespennest. Die Aggressivität gereizter Wespen war schon in der Antike bekannt, »noli irritare crabrones« (nicht die Hornissen reizen) lautete eine lateinische Redewendung. Der Dichter Matthias Claudius (1740-1815) empfahl deshalb: »Greif nicht in ein Wespennest, doch wenn du greifst, so greife fest.« Er meinte damit, daß man etwas Unangenehmes erst gar nicht wecken oder es beherzt hinter sich bringen sollte.
Ein Stück vom Kuchen abhaben...wollen Leute, die sich einen Anteil an etwas Erstrebenswertem nehmen, sich nicht mit dem Minimum zufriedengeben - niemand will immer nur einfaches Brot essen, wenn er auch mal vom lecker Kuchen kosten kann.
Ein Tropfen auf den heißen Stein...ist im Volksmund etwas, das angesichts des bestehenden Bedarfs viel zu wenig, unbedeutend, wirkungslos ist: Man tut zwar etwas, aber eigentlich bringt es überhaupt nichts, ist es völlig sinnlos - so wie ein Wassertropfen auf einem heißen Stein sofort verdunstet, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen.
Ein Unglück kommt selten allein...sagt ein uraltes Sprichwort. Wer kennt das nicht: Irgendwas geht schief, gleich drauf das nächste und bald nochwas. Widrige Ereignisse treten häufig gleichzeitig ein, wenn etwas Unangenehmes geschieht, folgen weitere Ärgernisse auf dem Fuße. Diese Erkenntnis beschreibt schon das Alte Testament: »Hæc dicit Dominus Deus adflictio una adflictio ecce venit« - »So spricht der Herr: Sihe, Es kompt ein vnglück vber das ander« (Hesekiel 7.5)
Ein weites FeldDazu ließe sich noch viel sagen. Den größten Anteil an der Verbreitung hat wohl Henri Theodor Fontanes (1819-98) Roman »Effi Briest« (1895), wo es heißt: »Ach Louise, laß, das ist ein weites Feld«. Jedoch schrieb der österreichische Schriftsteller Adalbert Stifter (1805-68) bereits in seinem 1857 erschienenen Erziehungs- und Bildungsroman »Der Nachsommer«: »Das ist ein weites Feld, von dem Ihr da redet«.
Ein Wink des SchicksalsDas Schicksal als Zeichen göttlicher Ordnung verstand man ab dem 16. Jahrhundert als Kombination aus »fatum« (Götterspruch) und »disposito« (Ordnung, Lenkung). In den Mythen der Antike beeinflußten Göttinnen wie die griechischen Moiren oder die römischen Parzen das Leben eines Menschen. Sie konnten ihn mit Glück überhäufen oder ins Verderben stürzen. Gaben sie ihm aber einen Hinweis, konnte er seinem Schicksal entgehen.
Ein Wort gibt das andere...und es kommt zu einem heftigen Wortwechsel: Erst flachsten sie ganz harmlos, dann gab ein Wort das andere, plötzlich flogen die Fäuste. In Walter Jens' (*1923) Roman »Der Mann, der nicht altwerden wollte« heißt es: »Als Maria davon erfuhr, stellte sie Fiechtner zur Rede. Ein Wort gab das andere, beide wurden heftig« (S. 98).
Einbildung ist auch eine Bildung...und bei manchem die einzige...
Dieses Wortspiel gebrauchen wir scherzhaft, um einer überheblichen Person deren eingebildete Äußerung oder selbstgefälliges Verhalten zu kommentieren. So mancher bildet sich halt nur ein, gebildet zu sein.
Einbleuen...heißt, jemandem etwas durch ständige, eindringliche Wiederholung, mit großem Nachdruck, notfalls mit Gewalt beizubringen, einzutrichtern: Auch wenn man jetzt glauben mag, das Wort hätte möglicherweise damit zu tun, daß jemand ein »blaues Auge« davonträgt - es stammt ursprünglich vom althochdeutschen »bliuwan« (schlagen) ab und hat etymologisch gar nichts mit »blau« zu tun. Somit ist natürlich auch die hin und wieder auftauchende Form »einbläuen« aus der sogenannten »Neuen Rechtschreibung« mal wieder völliger Humbug...
Eine Abfuhr erteilen...wir jemandem, den wir zurückweisen, eine Bitte, einen erwarteten Gefallen ablehnen: »Kommt, lasset von Tonne zu Tonne uns eilen - wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen«! blödelte einst der grandiose Komiker Heinz Erhardt (1909-79) und verband in seinem »Chor der Müllabfuhr« selbige gekonnt mit dieser Redensart. Ursprünglich war die »Abfuhr« die einseitige Beendigung der Mensur in schlagenden Burschenschaften: Dabei stehen sich zwei Paukanten verschiedener Verbindungen im Duell gegenüber. Kann eine der beiden Seiten - vielleicht wegen schlimmer Verletzungen durch die Degenhiebe - nicht mehr weiterfechten, ist der Kampf vorzeitig beendet, wenn der Sekundant die »Abfuhr« erklärt und den Fechter »abführt«.
Eine Abreibung verpassenDie »abreybung« kommt ursprünglich aus der Tierpflege und natürlich werden hier die Tiere nicht verprügelt, sondern durch Striegeln und Reiben das Fell gesäubert. Der Begriff ist schon seit dem 17. Jahrhundert belegt - seine heutige Bedeutung »bestrafen« taucht erstmals 1930 bei dem Schriftsteller und Journalisten Kurt Tucholsky (1890-1935) auf.
Eine Bank sein...heißt, daß man sich auf jemanden oder etwas unbedingt verlassen kann. Einst ging es wohl um die Bank zum Sitzen, die - anders als ein einfacher Schemel oder Stuhl - nicht so leicht umgeworfen werden kann. Als »Bank« bezeichnen Totospieler auch eine Tippreihe, in der durchgehend dasselbe Ergebnis vorhergesagt wird, weil man sich über den Ausgang eines Spiels völlig sicher ist. Und nicht zuletzt meinte man auch, sich auf die Geldinstitute selbigen Namens verlassen zu können - diverse Bankenkrisen machten die bekannte Metapher hier allerdings eher zum Euphemismus...
Eine bittere Pille schlucken...müssen wir gelegentlich, um uns mit etwas Unangenehmem abzufinden und es für die Zukunft zu verbessern. Viele Medikamente werden aus Erdöl hergestellt, andere aus Pflanzen, die als Schutz vor Freßfeinden oft scharf, bitter oder sauer schmecken. Wirklich lecker ist wohl keines - aber wenn's hilft...
Eine Blöße geben...heißt, eine Schwäche zu verraten - ebenso wie ein Fechter, der seine Deckung aufgibt.
Eine breite PaletteEine »Palette« ist eigentlich das Farbmischbrett des Malers. Im übertragenen Sinne spricht man von einer »breiten Palette«, wenn ein Angebot so vielfältig ist, wie die einzelnen Farbnuancen auf dieser Malerscheibe.
Eine dicke Lippe riskieren...Leute, die besonders großmäulig und vorlaut auftreten: Nach altem rustikalen Brauch könnte man versucht sein, ihm dieselben mittels einiger gutgezielter Schläge zu verpassen.
Eine Durststrecke vor sich habenEs ist das Bild vom Wanderer in der Wüste, der nach großen Qualen endlich auf die Wasserstelle trifft, das zu der Redensart geführt hat. Finanzielle Schwierigkeiten, eine sportliche Niederlage nach der anderen - es sind Entbehrungen aller Art, die als »Durststrecke« bezeichnet werden.
Eine ehrliche Haut...nennen wir umgangssprachlich einen aufrichtigen, ehrlichen, redlichen Menschen, der oft infolge eben dieser seiner Rechtschaffenheit übertölpelt wird. Die Haut, die den ganzen Körper umhüllt, steht hier als »pars pro toto« für den darin steckenden Menschen, den sie quasi zusammenhält. Im Volksmund steht die Haut oft als Sinnbild für das Selbst: Die »arme Haut«, der bedauernswerte Mensch, der hart arbeiten muß, ist uns ebenso geläufig, wie die hochempfindliche »dünne Haut« oder die träge und arbeitsscheue »faule Haut«, auf der mancher so gern liegt.
Eine Extrawurst braten...wir jemandem, den wir bevorzugen, außer der Reihe behandeln oder Sonderwünsche erfüllen: Eine Wurst war im Mittelalter für arme Leute eine eher seltene Delikatesse, sodaß die Gewährung gar einer zusätzlichen »Extrawurst« sicher ein ganz besonderes Privileg darstellte. In Österreich ist die »Extrawurst« übrigens tatsächlich eine Wurstsorte (eine gedrungene Brühwurst), was hin und wieder für allgemeine Erheiterung bei deutschen Fleischfachverkäuferinnen sorgt.
Eine Flasche sein...kommt möglicherweise vom italienischen »fiasco« - »Flasche«, das als deutsches Fremdwort »Mißlingen, absolutes Scheitern« bedeutet.
Eine Gabe Gottes...haben Menschen, die über eine besondere Begabung - sei es in der Kunst oder im Umgang mit Menschen - verfügen können. König Salomo sagt, nachdem er die Hinfälligkeit allen menschlichen Tuns beschrieben hat: »Et cognovi quod non esset melius nisi lætari et facere bene in vita sua omnis enim homo qui comedit et bibit et videt bonum de labore suo hoc donum Dei est« - »Darumb merckt ich das nichts bessers drinnen ist denn frölich sein vnd jm gütlich thun in seinem Leben. Denn ein jglicher Mensch der da isset vnd trinckt vnd hat guten mut in alle seiner arbeit. Das ist eine gabe Gottes« (Prediger 3:12f).
Eine große Rolle spielen...wir nicht immer - oft ist unsere Rolle im Leben eher klein oder gar völlig unbedeutend. In der Schauspielerei gibt es von jeher Haupt- und Nebenrollen. Seit dem 17. Jahrhundert hatten Schauspieler bei Proben ihren jeweiligen Text auf Papierrollen notiert. Der zu sprechende Absatz war oben abzulesen, dann wurde die Rolle weitergedreht. Die Hauptdarsteller hatten somit eine größere Rolle als andere.
Eine Hand wäscht die andere...gib etwas und Du bekommst etwas - eine Gefälligkeit wird umso lieber erwiesen, je sicherer man auf eine Gegenleistung hoffen kann. Die Sentenz deutet gegenseitige Hilfe zum beiderseitigen Vorteil an - bedeutet aber auch, daß illegale Geschäfte oft ungesühnt bleiben, wenn sich die Täter gegenseitig decken und miteinander kungeln, sich kleine Gefälligkeiten in der Grauzone von Hilfe und Korruption leisten.
Ursprung ist die lateinische Übersetzung »Manus manum lavat« - (Eine) Hand wäscht (die andere) Hand - eines Verses des griechischen Komödiendichters Epicharmos (um 540-460 a.C.) durch Lucius Annæus Seneca (um 1-65) in seiner Schmähschrift »Apocolocyntosis« (Verwandlung in einen Kürbis, Veräppelung). Auch Titus Petronius Arbiter (um 14-66) nutzte die Wendung in seinem Schelmenroman »Satyricon«. Die Übertragung ins Deutsche findet sich 1827 in Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) Gedicht »Wie Du mir, so ich dir«, wo es heißt:
»Mann mit zugeknöpften Taschen,
Dir tut niemand was zulieb:
Hand wird nur von Hand gewaschen;
Wenn Du nehmen willst, so gib!«
Eine harte Nuß knacken...heißt umgangssprachlich, ein schwieriges Problem oder eine unangenehme Aufgabe lösen zu müssen. Das wird nicht immer einfach sein - genau, wie sich manche besonders harten Nüsse nur mit erheblichem Kraftaufwand und spezieller Technik knacken lassen.
Eine heilige Kuh schlachten...heißt, eine bislang unantastbare Sache ändern, ein Tabu brechen: Die »Heilige Kuh« gilt in vielen landwirtschaftlich oder nomadisch geprägten Kulturen aus religiösen oder ökonomischen Gründen als Statussymbol und Gradmesser des Vermögens, das durch eine Schlachtung vernichtet würde. Sie liefert nicht nur Nahrung und Bekleidung, sondern auch wertvollen Dünger, Behausung, Medizin und Arbeitskraft und man schlachtet sie erst dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Noch heute gelten Kühe bei den Hindus als heilige Tiere und sind als solche unantastbar.
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus...sagt das Sprichwort. Seinesgleichen schont man, unter Gleichgesinnten hält man zusammen - eine Tatsache, die wohl jedem bekannt sein dürfte, der jemals gegen Angehörige eines »höheren« Standes vorgehen wollte oder mußte. Das Bild stammt vom Zusammenhalt der Rabenvögel: Weil sie sich in ihrem Habit untereinander zum Verwechseln ähneln, kann man sie kaum unterscheiden. Krähen entwickeln darüber hinaus ähnlich wie Primaten Gemeinschaften mit ihren Artgenossen, arbeiten mit ihnen zusammen, bilden lebenslange Paarbindungen und schmieden kaum Bündnisse außerhalb dieser Beziehung. So prägte schon der römische Philosoph Macrobius Ambrosius Theodosius (um 385-430) die Weisheit: »Cornix cornici numquam oculos effodit« (Eine Krähe kratzt nie der anderen das Auge aus).
Eine lange Dürre wird kommen...erklärt mancher wenig charmant, wenn eine ziemlich große, lange, schmächtige, hagere, dünne Frau in Erscheinung tritt. Glaubt man einem uralten Kalauer, stand schon in der Bibel, daß Jesus durch die Wüste ging und ihm eine große Dürre folgte. Das stimmt so zwar nicht (es ist auch nicht überliefert, daß der Messias überhaupt eine Geliebte gehabt haben soll), allerdings wird mehrfach über lang andauernde Trockenperioden berichtet, die nicht nur das Land verwüstet haben, sondern auch große Hungersnöte - mithin also unfreiwillige Diäten - auslösten. Und so schließt sich der Kreis für dieses alberne Wortspiel...
Eine lange Nase machen...besonders Kinder gern mal jemandem, den sie verspotten und auslachen, weil sie den Anderen für einen Narren halten. Die Wendung bezieht sich auf die Gebärde, bei der man mit gespreizten Händen die Nase verlängert. Die Radierung »Das Fest der Narren« (1559) des flämischen Malers Pieter Brueghel der Ältere zeigt erstmals dieses Bild; lange Nasen aus Wachs oder Pappmaché waren von mittelalterlichen Satiren wie »Das Narrenschiff« (1494) über die Commedia dell’arte der Renaissance bis zur rheinischen Fastnacht das Attribut der Narren.
Eine Lanze brechenRitter konnten stellvertretend für ihren König oder Fürsten am Turnier teilnehmen und dort »eine Lanze für ihn brechen«. Andere Recken erwählten vor den Wettkämpfen eine Dame ihres Herzens, der sie den Sieg widmeten - auch für diese »brachen sie ihre Lanze« am Schild des Gegners.
Eine Laus in den Pelz setzenWir wollen jemanden ärgern, ihn verunsichern und schier zur Raserei treiben: Seit es Tiere und Menschen gibt, gibt es auch Läuse. Dies war einst so bekannt, daß die Resensart eher im Sinne von »Eulen nach Athen tragen« gebraucht wurde. Man brauchte niemandem eie (zusätzliche) Laus in den Pelz zu setzen - es waren immer schon genug da...
Eine Laus über die Leber gelaufen...ist jemandem, der schlechtgelaunt, zickig oder schmollend daherkommt. Die Redensart hat ihren Ursprung in der Annahme, daß unsere Leber der Sitz leidenschaftlicher Empfindungen sei. Der Mediziner Galenus (um 129-199), einer der bedeutendsten Ärzte der Antike, glaubte fest daran, daß die vier Lebenssäfte Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle sowie das Temperament und Gefühle wie insbesondere der Zorn, aber auch Liebe oder Trauer aus der Leber kämen. Diese Vorstellung hielt sich noch bis in das 17./18. Jahrhundert. Ursprünglich hieß es einfach nur: »Es ist ihm etwas über die Leber gelaufen«. Die Laus kam dann als Sinnbild für einen geringfügigen Anlaß, eine Nichtigkeit dazu.
Eine Lawine ins Rollen bringenOft reicht eine Bemerkung oder ein Ereignis, um eine unaufhaltsame Kettenreaktion auszulösen - ähnlich wie eine Lawine, die mit unvorstellbarer Wucht riesige Schneemassen ins Tal stürzt und dabei alles und jeden mitreißt.
Eine Leiche im Keller haben...Menschen, die vermeintlich etwas Belastendes verbergen. Schon in Theodor Fontanes (1819-98) Novelle »Unterm Birnbaum« geht es um einen Dorfwirt, der einen Schuldeneintreiber umbringt und im Keller seines Wirtshauses verscharrt. Zwar lenkt er durch einen Trick jeglichen Verdacht von sich, doch der Fluch der bösen Tat belastet ihn: Er wird immer nervöser, schaut immer öfter in den Keller und schließlich findet man auch ihn tot neben der halb ausgegrabenen Leiche.
Eine Macke haben...Zeitgenossen, mit denen irgendwas nicht stimmen kann, die gar absonderliche Eigenheiten oder Angewohnheiten pflegen, die eigensinnig, einfach ein bißchen verrückt sind - was sie ja durchaus manchmal liebenswerter machen kann -, aber auch Gegenstände, die beschädigt sind oder nicht richtig funktionieren, die einen Knall, einen Schlag oder Hieb abbekommen haben: Nichts anderes bedeutet das jiddische »makke« - Schlag, Hieb, Streich.
Eine milde GabeDie »Milte« war eine mittelalterliche Fürsten- und Rittertugend, die Pflicht zur Fürsorge gegenüber Gefolgsleuten, Gesinde und sonstigen Bedürftigen.
Eine Mütze voll Schlaf...ist heute umgangssprachlich »ein kleines Nickerchen«, damit man wieder fit ist. Das mag früher anders gewesen sein: Man dachte wohl ursprünglich eher an den nächtlichen Tiefschlaf, zu dem man sich eine »Schlafmütze« aufsetzte, ehe man sich zum Schlafen hinlegte. Da man im Schlafzimmer keine Heizung hatte, trugen Männer eine weiche Zipfelmütze, Frauen eine Haube, um sich vor der Kälte zu schützen. Darüber hinaus verringerte man so das Risiko, Läuse zu bekommen.
Eine Nasenlänge voraus...sind wir unserer Konkurrenz, wenn wir knapp gewinnen, einen hauchdünnen Sieg davontragen. Diese Wendung kommt aus dem Galoppsport: Kommen zwei Pferde nahezu gleichzeitig ins Ziel, kann dennoch nur eins gewinnen - das, das den Kopf »eine Nasenlänge voraus« hat.
Eine rote Linie überschreiten...heißt, etwas tun, das nicht mehr toleriert werden kann, einen Tabubruch begehen. Die Farbe Rot steht symbolisch nicht nur für die Liebe, sondern viel mehr noch für Warnung und Verbot; rote Linien markieren geschützte Zonen oder Absperrungen, die nicht übertreten werden dürfen. Möglich wäre eine Herkunft aus dem Gedicht »Tommy« von Rudyard Kipling (1865-1936), der die Schlacht von Balaklawa (heute ein Stadtteil von Sewastopol) 1854 auf dem Höhepunkt des Krimkriegs (1853-56) verarbeitet, wo die mit roten Jacken bekleideten Schotten eine »Thin Red Line« - eine dünne rote Verteidigungslinie gegenüber den angreifenden Russen bildeten.
Eine ruhige Kugel schieben...natürlich nicht nur unsere Beamten, denen man so gerne nachsagt, daß sie weniger arbeiten als faulenzen. Bei diesem seit dem frühen 20. Jahrhundert immer beliebteren geselligen Spiel ist Schnelligkeit nicht unbedingt vonnöten - man kann zwischen den Würfen ganz entspannt plaudern und das eine oder andere Gläschen heben. Fouls sind praktisch unmöglich, es kommt lediglich darauf an, die Kugel nicht zu werfen, sondern sanft und rund, aber mit Schwung auf die Bahn zu setzen - eben »eine ruhige Kugel zu schieben«. Eine sportliche Betätigung, die uns mit zunehmendem Alter allen immer mehr entgegenkommt...
Eine Scharte auswetzen...mußte derjenige, dessen Schwert im Kampf Scharten erhalten hatte. Heute eher nur noch beim Mähen kann es passieren, daß die Sense auf einen Stein trifft, was eine Scharte im Schneidblatt zur Folge hat. Diese wird mit dem Wetzstein wieder ausgeglichen, also ausgewetzt. Allgemein heißt es also, einen dummen Fehler oder eine peinliche Niederlage versuchen, wieder gutzumachen.
Eine Schippe drauflegen...heißt, bei etwas schneller oder besser werden, sich beeilen, etwas vermehren oder vergrößern.
Die Redewendung kommt ursprünglich schon aus der Eisenbahnersprache in der guten alten Zeit der Dampflokomotiven: Auf dem Führerstand arbeitete damals neben dem Lokführer ein Heizer, der den einen oder anderen Zentner Kohle in die Feuerbüchse schaufeln mußte. Mit jeder zusätzlichen Schippe, die er »drauflegte«, stieg die Temperatur und der Dampfdruck und der Zug wurde immer schneller.
Eine Schlange am Busen nähren...heißt, jemandem Gutes tun, den man für einen Freund hält, der sich aber später als undankbar und verräterisch erweist: In Æsops Fabel »Der Bauer und die Schlange«, heißt es: »Er nahm die Schlange und legte sie unter den Bausch seines Gewandes«. Später erwachte die vor Kälte erstarrte Kreatur wieder zum Leben und statt dankbar zu sein, biß und tötete sie ihren Retter Die Vorstellung von der Milch trinkenden Schlange kam erst später dazu.
Eine Schlappe einsteckenJemand erleidet eine Niederlage: Eine »Schlappe« war im Frühneuhochdeutschen der leichte Schlag oder Klaps mit der Hand - abgeleitet von dem Lautwort »schlapp«, den ein klatschender Laut wie eine Ohrfeige erzeugt. Wer bei einem Kampf oder Duell mit Fäusten den Kürzen zog, war nunmal unterlegen und hatte »eine Schlappe« eingesteckt.
Eine schöne Stange Geld...kostet etwas, das sehr teuer ist: Münzgeld wird hintereinander aufgereiht in Papier eingerollt, also in »Stangen« aufbewahrt. Eine »schöne Stange« ist halt besonders lang und enthält eben ziemlich viel Kleingeld.
Eine Schraube locker haben...umgangssprachlich Leute, die man für leicht verrückt hält: Man vergleicht das menschliche Gehirn mit einem Räderwerk aus vielen Einzelteilen. Diese Vorstellung vom Menschen als einer Art Maschine geht auf den französischen Philosophen Rene Descartes (1596-1620) zurück, einem Vertreter des Rationalismus. Er betrachtete Menschen und Tiere als von Gott geschaffene Wesen, die in vielerlei Hinsicht Automaten glichen. Dazu zählte er auch den Blutkreislauf, den er mit einem Fluß verglich und das Herz mit einem Ofen.
Eine Schwalbe macht noch keinen SommerDie Schwalbe, ein Zugvogel, der in Afrika überwintert und im Frühjahr wieder zu uns zurückkehrt, gilt gemeinhin als Verkünderin des Frühlings. Die Warnung, aus bestimmten Anzeichen keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, geht zurück auf eine Fabel des griechischen Dichters Æsop. Dort wird von einem jungen Mann berichtet, der in kurzer Zeit sein ganzes Erbe durchgebracht hat. Als er nun die erste Schwalbe im Frühling sieht, vertraut er auf den Beginn der warmen Jahreszeit und verkauft seinen Mantel. Doch es folgen kalte Tage, in denen die Schwalbe erfriert. Als er sie später tot auffindet, macht er ihr Vorwürfe, weil sie ihn ruiniert habe und bezichtigt sie des Betruges.
Auch der griechische Philosoph und Naturforscher Aristoteles (384-322 a.C.) berichtet: »Denn eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und auch keinen Tag; ebenso macht auch ein einziger Tag oder eine kurze Zeit niemanden gesegnet oder glücklich«. (Nikomachische Ethik I 6 1098 a 19-20)
Eine spitze Zunge haben...umgangssprachlich Zeitgenossen, die in Gesellschaft häufig spöttische Bemerkungen machen, die durchaus belustigen - aber auch verletzen können wie eine Messerspitze. Der Begriff »spitze Worte« findet sich schon im Wörterbuch der Gebrüder Grimm; die »Zunge« steht in der Dichtung synonym für »Sprache«; im Lateinischen bedeutet das Wort »lingua« ohnehin beides. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) meinte dazu: »Hand will lieber Worte kritzeln, aber nur zum Notbedarf; Zunge liebet mehr zu witzeln, karg zu sein und spitz und scharf«.
Eine Stecknadel fallen hören...können wir sprichwörtlich, wenn es absolut mucksmäuschenstill ist. Nein - eigentlich können wir es nicht wirklich, aber wir nutzen diese Metapher gern, wenn es außergewöhnlich still ist, weil zum Beispiel alle so sehr auf eine Sache konzentriert sind, daß es keinerlei Nebengeräusche mehr gibt.
Eine Tracht Prügel...sollten Kinder heutzutage nicht mehr bekommen - qua Gesetz haben sie ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Bezüglich der Herkunft des Begriffes gibt es verschiedene Vermutungen: Das Wort Tracht kommt vom Althochdeutschen drahta und bedeutet »alles, was getragen wird«. Die Tracht Prügel könnte also bedeuten: »so viel man ertragen kann«. Tracht nannte man aber auch die Folge aufgetragener Speisen. Vielleicht wurden deshalb auch die aufeinanderfolgenden Schläge als Tracht bezeichnet.
Eine Volte schlagen...Leute, die ihre grundsätzliche Meinung urplötzlich ändern und eine diametral andere vertreten, also eine rasche Wendung vollziehen: Im Fechtsport ist die »Volte« ein Ausweichschritt, den man macht, um anschließend von der Seite her angreifen zu können, in der Reiterei eine Wendung, die das Pferd um sich selbst herum macht, und im Kartenspiel, besonders bei Taschenspielern, eine geschickte Wendung der Finger, die der Karte unbemerkt eine andere Lage geben.
Eine weiche Birne haben...Leute, die nicht so ganz normal, etwas verrückt, hohl im Kopf sind: Der scherzhafte Vergleich der menschlichen Kopfform mit einer Birne findet sich ebenso häufig, wie auch mit Nüssen, Wirsing, Kürbis, Rübe und anderem meist eher preiswerten Gemüse. Eine überreife, vielleicht schon etwas angefaulte »weiche Birne« ist nicht mehr allzu lange haltbar, also recht minderwertig - bildlich wird dies auf den Kopf übertragen.
Eine weiße Weste haben...Leute, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Die Farbe Weiß gilt in unserer Kultur als Sinnbild der Reinheit und Unschuld. In diesem Sinne sagte Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-98) im Oktober 1892, als ein Abgesandter aus Afrika zurückkehrte: »Er ist mit einer vollständig tadellosen weißen Weste aus Afrika zurückgekommen«. Schon im Jahre 1866 hatte er gegenüber General Moltke erklärt: »Wir haben bisher keinen Flecken auf der weißen Weste«.
Eine Wucht kriegen...unartige Kinder, die eine saftige Tracht Prügel beziehen, weil sie mal wieder was angestellt haben. Die Schläge treffen sie »mit voller Wucht« - ostmitteldeutsch für »Gewicht, Schwere« - einem Impuls kinetischer Energie eines bewegten Körpers, wie der strafenden elterlichen Hand, des Rohrstocks, Teppichklopfers oder was immer für Gerätschaften hierfür geeignet erscheinen. Unter heutigen pädagogischen Gesichtspunkten ist eine solche Therapie selbstredend strikt abzulehnen...
Eine Zigarre verpassen...uns üblicherweise Vorgesetzte. Das Wort geht wohl auf ein stilvolles Tadeln bei der deutschen kaiserlichen Marine zurück: Hatte der Kommandant an einem Offizier etwas auszusetzen, bestellte er ihn zu sich und bot ihm dann zunächst einmal eine Zigarre an...
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins MaulDieses Bild benutzte bereits der Kirchenvater Hieronymus (347-420) in der Einleitung seines Kommentars zum Epheserbrief: »Noli equi dentes inspicere donati« (Du sollst einem geschenkten Gaul nicht die Zähne inspizieren).
Es war einst üblich, daß man im Pferdehandel den Wert des Tieres ermittelte, indem man ihm ins Maul sah und den Zustand des Gebisses prüfte. Die gute Absicht des Schenkenden sei jedoch höher zu werten, als mögliche Mängel.
Spaßvögel behaupten davon abgewandelt auch: »Einem geschenkten Barsch schaut man nicht in die Kiemen« - oder wo es sich halt reimt...
Einem hungrigen Magen ist nicht gut predigen...weil ein Mensch, der in Not und Elend lebt, kaum ein gesteigertes Interesse an einem imaginären Himmelreich haben wird. Zunächst müssen einmal die Grundbedürfnisse wie Nahrung, aber auch Obdach, Kleidung und Gesundheit befriedigt sein, ehe Ideologie oder Moral überhaupt interessant werden. Schon Marcus Porcius Cato wußte vor über 2000 Jahren: »Es ist ein schwer Ding, zum Bauche zu reden, der keine Ohren hat«.
Einem Laster frönen...Menschen, die - oft wider besseren Wissens - die angenehmen Seiten einer Leidenschaft in vollen Zügen genießen, die eine Angewohnheit ausleben, die gemeinhin als schlecht oder unangenehm empfunden wird. Der Begriff geht auf den mittelalterlichen »Frondienst« zurück, eine unentgeltliche Arbeit leibeigener Bauern für ihren Lehnsherren, vor der es kein Entrinnen gab, die zu erbringen war - ob man wollte oder nicht.
Einem nackten Mann in die Tasche fassen...ist ein Unterfangen, das regelmäßig zum Scheitern verurteilt ist: Wer »einem nackten Mann in die Tasche« greift, versucht dort etwas zu holen, wo nichts zu holen ist. Und das kann eben nicht klappen: Einem Armen noch etwas wegzunehmen, jemanden auszuplündern, der ohnehin schon nichts besitzt, ist etwas Unmögliches.
Einen Affen habenDieses Synonym für »betrunken sein« geht auf die angebliche Trunksucht des Affen zurück - Affen nennt man aber auch die Tornister des Sturmgepäcks der Soldaten. Wer weiß, daß der gemeine Wehrpflichtige gern mal einen über den Durst trinkt, für den schließt sich der Kreis...
Einen alten Baum verpflanzt man nicht...meint, daß man einen alten Menschen nicht mehr aus seiner Wohnung, seiner Umgebung herausreißen soll, wie man auch einen alten Baum nicht mehr verpflanzt, weil er da gefestigt ist, sich wohlfühlt und es möglicherweise nicht überleben würde.
Einen an der Klatsche haben...umgangssprachlich Leute, die wir für ein bissl verrückt, für unzurechnungsfähig halten, die wohl »nicht recht bei Verstand« sein können. Diese noch junge Redensart kam erst in den 60er/70er Jahren auf, als die »Deutsche Synchron« zahllose ausländische TV-Serien nicht nur einfach in die deutsche Sprache übertrug, sondern - mehr oder minder erfolgreich - versuchte, sie sprachlich »aufzupeppen«. Rainer Brandt, ein Berliner Synchronsprecher und Autor, fand, daß deutsche Fassungen oft zu steril und gegenüber den Urversionen auch falsch übersetzt seien und schrieb fortan selbst frech-ironische Dialoge, in die er Berlinismen, Jiddisch, Unterwelt- und Gossenjargon einfließen ließ. Fernsehserien wie »Die Zwei« oder »Rauchende Colts«, aber auch die »Bud Spencer-Filme«, die mit dem Original meist nicht mehr viel gemein hatten, wurden erst durch solche mittlerweile Kalauer berühmt.
Einen an der Waffel haben...Leute, die womöglich nicht ganz bei Verstand sind: Anders als man meinen könnte, hat dieser Ausdruck aber mit dem Gebäck überhaupt nichts zu tun - er geht vielmehr auf das Verb »waffeln« zurück, eine veraltete Form von »schwafeln, schwatzen«. In ihrem Deutschen Wörterbuch (ab 1832) führen die Bruder Grimm die Waffel als Dialektausdruck für »Mund, Maul« oder einen geschwätzigen Menschen auf. Auch im Englischen heißt »to waffle« schwafeln, faseln, Unsinn reden, was auf »waff« (bellen) zurückgehen soll.
Einen auf die Lampe gießen...wir, wenn wir in geselliger Runde größere Mengen alkoholischer Getränke verkasematuckeln. Die Wendung, die sich bereits im 12. Jahrhundert in einer Sprichwortsammlung des Archipoeta (um 1125-65) findet, geht wohl auf das altgriechische »lampo« zurück, was »ich leuchte« bedeutet. Möglich, daß dies mit der rotleuchtenden Säufernase zu tun hat, die wie einst die alten Petroleum- und Öllampen regelmäßig nach Brennstoff verlangt. Es könnte aber eher auch um die erheiternde Wirkung des Alkohols gehen, die man einst lateinisch »Illumination« - »Erleuchtung« - nannte.
Andere verorten die Redensart in die Zeit der Gaslaternen: Das Gas in den Steigleitungen ist feucht, im Winter froren sie oft ein und mußten mit Spiritus, der in eine eigens dafür vorgesehene Öffnung gegossen wurde, aufgetaut werden. Damals unterschied man den Hochprozentigen noch nicht wie heute in Trink- und (wegen der Branntweinsteuer künstlich vergällten) Brennspiritus - was lag also näher, als diese »Spirituose« gegen die Kälte auch gleich selbst einzunehmen?
Einen Bären aufbinden...stammt wohl aus einer Zeit, als in Europa »Problembären« noch einfach so herumlaufen durften: Schon damals wollte jeder Jäger einen solchen erlegen, da ihm das Ruhm und die Bewunderung seiner Mitmenschen einbrachte - allein so mancher mag es mit der Wahrheit wohl nicht ganz so genau genommen haben. In Wirklichkeit dürfte ihre Beute oft viel kleiner als das »Jägerlatein« gewesen sein, wo gern mal ein Bär gefesselt, »angebunden« wurde. Aus »anbinden« entwickelte sich mit der Zeit wohl »aufbinden«. Eine solche Jagdgeschichte ist erstmals bereits 1669 in Johann Jakob Christoph von Grimmelshausens (1622-76) Roman »Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch« belegt: »...daß ich ihnen, wenn ich nur aufschneiden wollen, seltsame Bären hätte anbinden können«.
Eine andere Deutung sieht hier das alte Wort »bere« oder »bäre« für eine »Abgabe«.
Möglicherweise ist »Bär« hier aber auch eine Übertragung des mhdt. »bar« (Last, Bürde, Balken). So nannte man früher auch das eiserne Fallgewicht an Schmiedehämmern und -rammen.
Einen Bärendienst erweisen...heißt, jemandem trotz guter Absicht zu schaden. Die Redewendung ist seit ca. 1900 in Gebrauch und geht auf die Fabel »L'ours et l'amateur des jardins« (Der Bär und der Gartenliebhaber) von Jean de la Fontaine (1621-95) zurück. Dort will ein Bär diensteifrig eine Fliege von der Nase des schlafenden Gärtners verscheuchen, indem er einen Pflasterstein nach ihr wirft, was weder die Fliege noch der Gärtner überleben:
Ein halb geleckter Bär, dem Hochgebirg' entstammt, | lebt', gleich Bellerophon, den einst das Schicksal steigen | und fallen ließ, im Wald zur Einsamkeit verdammt. | Verrückt ward er; denn der Vernunft ist's eigen, | daß sie nie lang bei Eremiten bleibt. | Reden ist Silber, sagt man, Gold ist Schweigen; | doch beides ist nicht gut, wenn man es übertreibt. | Kein lebend Tier mocht' da sich zeigen, | leer blieb's und öde ganz und gar, | sodaß, obwohl ein Bär er war, | er höchst langweilig fand dies jämmerliche Leben. | Indes er also hier der Schwermut sich ergeben, | langweilte ganz auf gleiche Weis' | in seiner Nähe sich ein Greis, | ein Gartenfreund, der in Pomonas Dienste schaltet | und Floras Priesteramt verwaltet. | Schön ist dies Doppelamt; doch glaub' ich, schöner sei's | in liebenswürdiger Freunde Kreis. | Ein Garten spricht nicht viel, außer in meinem Buche. | Drum ging der Greis einst auf die Suche | im Morgensonnenschein, der stummen Sippschaft satt, | nach Freunden; querfeldein wandelt' er frisch und munter. | Der Bär, der gleiche Absicht hatte, | kam auch von seinem Berg herunter. | Durch Zufall trifft höchst sonderbar | an einer Ecke sich das fremde Paar. | Der Mann hat Angst. Doch wie ausweichen? Was anstellen? | Mut heucheln war das Beste stets in solchen Fällen; | er wußt' es und verbarg die Furcht vor der Gefahr. | Der Bär, der nicht sehr höflich war, | sagt kurz zu ihm: »Komm zu mir!« Darauf jener: »Gerne zwar, | doch seht, da steht mein Haus; wollt Ihr mir Ehr' erweisen, | so eßt darin mit mir ein ländlich schlichtes Mahl. | Ich habe Obst und Milch. Zwar weiß ich nicht einmal, | ob die Herrn Bären auch gewohnt sind solche Speisen, | doch biet' ich, was ich hab'.« Der Bär nimmt's an, sie gehen; | man kann schon unterwegs sie als zwei Freunde sehn. | Im Hause haben sie sehr freundlich sich vertragen, | mag auch Alleinsein mehr behagen | als eines Narren Gegenwart, | so hindert, da der Bär in Schweigen meist verharrt, | doch nichts den Mann, daß er sein Tagewerk verrichtete. | Der Bär geht auf die Jagd, schafft Wild herbei, obliegt | dann seinem Hauptgeschäft vergnügt | als Fliegenjäger, scheucht vom Angesichte | des Freundes, wenn er schläft, das lästige Insekt, | die Fliege, die so oft uns neckt. | Einst sieht er unsern Greis in tiefem Schlummer liegen | und eine Fliege, die ihm auf der Nase kreucht; | er wütet, da umsonst er immer fort sie scheucht. | »Wart nur!« so ruft er aus. »Dich werde ich schon kriegen!« | Gesagt, getan: Seht da, der Fliegenmeister schafft | »nen Pflasterstein herbei und schleudert voller Kraft, | ihn nach des Greises Haupt, die Fliege zu verjagen. | Er hat - als guter Schütze, doch höchst mangelhaft | als Denker - auf der Stell' ihn mausetot geschlagen. | Nichts bringt so viel Gefahr uns wie ein dummer Freund; | weit besser ist ein kluger Feind.
Einen Bernhard machen...stammt aus der Fachsprache der Steinmetze: Wer durch falsches Messen, mißverstehen einer Zeichnung, oder ähnliches einen Stein »verhaut«, macht einen »Bernhard«. Für diesen Stein bekommt der Handwerker natürlich keine Bezahlung, wohl aber den Spott seiner Kollegen. Meist muß der Steinmetz auch noch einen »Leichentrunk« für den Stein ausgeben, ein »Bernhard« wird nämlich seit der Gotik in der Nähe der Hütte feierlich beigesetzt.
Einen Besen fressen...wir gelegentlich, wenn wir etwas für sehr unwahrscheinlich halten und gehen diese Wette ein, falls es doch eintreffen sollte. Da die Redewendung erst im 20. Jahrhundert belegt ist, geht sie wohl nicht auf magische Hexenbesen des Mittelalters zurück - für die Vorstellung, freiwillig solch schmutzige Haushaltsgegenstände zu verzehren, muß man sich seiner Sache dann aber doch schon ziemlich sicher sein.
Einen Blackout haben...wir hin und wieder bei einer wichtigen Prüfung: Der Streß ist enorm und wir wissen plötzlich nichts mehr vom Prüfungsstoff, obwohl wir uns doch eingehend vorbereitet haben. Manchmal endet auch ein veritabler Vollrausch in einem solchen »Filmriß«.
Der Ausdruck für einen vorübergehenden Gedächtnisverlust kommt ursprünglich vom englischen Boulevard-Theater: Kurz vor einer Pause machte man noch einen Witz, dann gingen schlagartig sämtliche Scheinwerfer aus und das Publikum wußte: Jetzt darf geklatscht werden.
Einen Dämpfer verpassen...wir gelegentlich Leuten, die wir »dämpfen«, zur Zurückhaltung auffordern, zurechtweisen. Die Redensart kommt aus der Akustik: Mit einem Schalldämpfer werden Lärmbelästigungen - sowohl in der Musik, im Maschinenbau, als auch in der Waffentechnik - auf ein erträgliches Maß reduziert.
Einen faulen Lenz machen...sich - längst nicht nur im Frühling - manche Müßiggänger, die Däumchen drehen, sich ausruhen, rumgammeln, nicht oder nur sehr wenig arbeiten. Wer nun vermutet, daß der »Lenz« etwas mit der Frühjahrsmüdigkeit zu tun haben könnte, irrt wohl - geht er doch höchstwahrscheinlich auf die Kurzform von »Lorenz« und weiter auf den lateinischen »Laurentius« zurück: Im 16. Jahrhundert ein recht gängiger Vorname, der wie »Hinz und Kunz« ob seines häufigen Gebrauchs allgemein als Gattungsbezeichnung für »Mensch, Kerl« stand. Darüber hinaus erinnert uns der »faule Lenz« auch noch frappant an »faulenzen« (mhd. »vulezen« - faulig schmecken, riechen).
Einen Filmriß haben...wir gelegentlich mal nach einem rauschenden Fest, wenn wir nach enormem Alkoholgenuß nicht mehr recht wissen, wie wir denn eigentlich nach Hause gekommen sind, manchmal aber auch in angespannten Situationen, wenn wir uns beispielsweise vor einer Prüfung partout nicht mehr an das Gelernte erinnern können. Das Bild stammt von einem Kinofilm, der mitten in der Vorführung reißt: War das bei den alten Zelluloidfilmen einmal der Fall, mußte sofort der Projektor abgeschaltet werden, damit der Film vor der starken Lampe nicht einbrannte. Im Zuschauerraum herrschte dabei minutenlang völlige Finsternis - wie in unserem Kopf, wenn die Erinnerung ausgesetzt hat.
Einen Fimmel haben...umgangssprachlich Leute, die eine Marotte, eine seltsame Angewohnheit pflegen, bei manchen Sachen einen übertriebenen Eifer an den Tag legen. Der »Putzfimmel«, bei dem jemand auch noch in der hintersten Ecke förmlich nach Schmutz sucht, sei hier nur ein Beispiel. Das Wort könnte auf das mittelniederdeutsche »femeln, fimmeln« - heute auch »fummeln« - zurückgehen, was etwa »heraussuchen, suchend umhertasten« bedeutete und wohl von der selektiven Ernte der früher reifenden und weniger wichtigen männlichen Hanf- oder Hopfenpflanze »Femel« kommt.
Einen Floh ins Ohr setzen...wir jemandem, dem wir geschickt etwas einreden, auf einen Gedanken, eine fixe Idee bringen, von der er nicht mehr loskommt, an die er immerzu denken muß. Dieser vermutlich unerfüllbare Wunsch beunruhigt und peinigt denjenigen, läßt ihn nicht mehr los - wie dieses verrückte Insekt, das unruhig auf und ab hüpft. Klar, daß kein vernünftiger Gedanke zu fassen ist, wo der Floh sein Unwesen treibt und im Ohr herumhüpft...
Einen Frosch im Hals haben...wir sprichwörtlich, wenn wir uns räuspern, einen trockenen Hals, einen »Kloß im Hals« haben. Tatsächlich hat der »Frosch« seinen Namen von dem medizinischen Fachbegriff »ranula«: Diese Mundbodenzyste, die sogenannte »Fröschleingeschwulst«, ein Diminutiv vom lateinischen »Rana« (Frosch), bezeichnet eigentlich eine Geschwulst der »Glandula sublingualis maior« (Unterzungen-Speicheldrüse) und liegt somit genaugenommen unter der Zunge und nicht im Hals. Eine deutlich vergrößerte Ranula sieht ein wenig wie die Schallblase eines quakenden Frosches aus und kann unter Umständen zu Schluck-, Sprech- und Atembeschwerden führen.
Einen Fuß in der Tür haben...Leute, die zwar ihr Ziel noch nicht ganz erreicht, aber doch immerhin schon Beachtung erlangt und auf sich aufmerksam gemacht, Einfluß bekommen haben.
Die Redensart geht auf die Zeit zurück, in der hartnäckige Handelsvertreter noch von Tür zu Tür eilten und ihnen dieselbe sehr häufig vor der Nase zugeschlagen wurde. Damit dies nicht passiere, sollen sie direkt einen Fuß in die Tür gestellt haben, sodaß der potentielle Kunde diese nicht richtig schließen konnte und der Verkäufer seiner Sache schon ein kleines Stückchen näher war. Ein geschickter Händler tat dies aber nur höchst selten, vielmehr verstand er es, sich durch kluge Argumente die Tür zum Verkaufserfolg offenzuhalten.
Einen gemeinsamen Nenner finden...geht auf die Bruchrechnung zurück: Um Brüche, bestehend aus Zähler (oben), Bruchstrich und Nenner (unten) addieren oder subtrahieren zu können, müssen sie erst durch Kürzen/Erweitern auf einen »gemeinsamen Nenner« gebracht werden, bevor die eigentliche Rechnung losgeht.
Einen guten Schnitt machenWir haben ein gutes Geschäft gemacht und einen erklecklichen Gewinn eingefahren: Schon als das Korn noch mit der Sense geschnitten wurde, konnte man überzähliges Getreide verkaufen. War die Scheune voll und hatte man darüber hinaus viel Korn verkaufen können, sprach man von einem »guten Schnitt«.
Einen Hammer haben...umgangssprachlich Menschen, an deren Verstand zu zweifeln ist, weil sie sich verhalten, als hätten sie mit dem Hammer einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekommen.
Einen kapitalen Bock gechossen...haben umgangssprachlich Leute, die einen größeren Fehler begangen, eine Dummheit gemacht haben. Der Ausdruck rührt wohl von den Schützengilden her, die seit 924 offiziell der Verteidigung der Städte dienten. Ab dem 15. Jahrhundert wurde es dort Brauch, dem schlechtesten Schützen zum Hohn, aber auch zum Trost, einen Schafsbock zu überreichen. Der »Schütze« kommt übrigens nicht vom »Schießen«, sondern vom »Schutz« her.
Einen Kater haben...wir manchmal nach einem feuchtfröhlichen Abend: Die »Veisalgia«, wie der Grieche die Folgen eines üppigen Rausches nennt, hat ihren Ursprung wohl nicht bei unseren »Felis catus«, sondern ähnelt frappant der Schleimhautentzündung »Katarrh« und fand über sächsische Studenten des 19. Jahrhunderts Eingang in unsere Umgangssprache. Anfangs war es wohl eher ein Begriff für ein allgemeines Unwohlsein, erst später wurde »Kater« für alkoholbedingte Problemchen gebräuchlich. Dazu beigetragen haben auch vorhandene Redensarten wie beispielsweise »verliebt wie ein Kater«, daraus entstand »besoffen wie ein Kater« und schwupps - schon war der arme Zimmertiger zum Alkoholmonster geworden.
Einen kleinen Mann im Ohr haben...angeblich Leute, die - wenigstens unserer Meinung nach - verrückt sein müssen, ganz einfach »spinnen«. Sagt jemand etwas völlig Unsinniges, das man sich halt nicht erklären kann, vermuten wir schnell, daß tatsächlich ein kleines Männchen in seinem Ohr sitzen müsse, das ihm dies eingeflüstert hat. Auch Ohrgeräusche (Tinnitus) führt mancher auf diese Vorstellung zurück - manchmal kommt der »kleine Mann im Ohr« allerdings auch nur von den kleinen Mini-Kopfhörern...
Einen Kloß im Hals haben...wir bildlich, wenn wir vor lauter Aufregung, Angst, Schmerz, Rührung nicht sprechen, atmen, singen können. Der »Globus hystericus« - ein Enge- oder Fremdkörpergefühl, oft begleitet von zitternden Händen, Schweißausbrüchen, Heiserkeit und versagenden Nerven - hat eher selten tatsächlich organische Ursachen. Da er oft im Hals von Schauspielern oder Sängern auftrat, entstand dieses Bild in der Theatersprache des 19. Jahrhunderts wohl abgeleitet von dem mit gepreßter Stimme singenden »Knödeltenor«.
Einen Knall haben...erklärt sein Gegenüber für verrückt. Auch diese Redensart stammt aus dem Mittelalter: »Knall« als kurzer, lauter Schall meint hier wohl einen kräftigen Schlag gegen den Kopf und den dadurch bewirkten Gehirnschaden. Davon abgeleitet ist auch der »Knallkopf«.
Einen Koller kriegen...manche Leute mit einem veritablen Wutausbruch. Das Wort geht auf das spätlateinische »cholera« (Gallenbrechruhr) zurück. Davon abgeleitet entstand die mittelalterliche Bedeutung »koloro« für Zorn oder Bauchweh und der »Choleriker« für einen jähzornigen Menschen. In der antiken Temperamentenlehre war die gelbe Gallenflüssigkeit Auslöser für Reizbarkeit und Ärger.
Einen Korb bekommen ...seit dem Mittelalter vorzugsweise männliche Verehrer, deren
...seit dem Mittelalter vorzugsweise männliche Verehrer, deren
Minnesang von der Angebeteten nicht erhört wird:
Nach einer Deutung ließen sehnsüchtige Burgfräulein einst ihre
Liebsten nachts heimlich mittels eines großen Korbes zu ihrer
Kemenate aufseilen. Zuweilen ließ man dem ungebetnen Galan
auch einen Korb hinab, dessen Boden so brüchig war, daß der
Genarrte alsbald abstürzte und ob dieser »bodenlosen«
Gemeinheit auch sonst »unten durch« war.
Eine Variante bestand darin, Freier auf halber Höhe »hängen zu
lassen«, später sandte man lästigen Anbetern gleich einen Korb
ohne Boden, um die Ablehnung deutlich zu machen.
Bereits Meistersinger Hans Sachs (1494-1576) sagte:
»Doch wenn er meint am festen steh, nehmt sie ein andern zu
der Eh, alsdenn so ist er vor ihn allen gantz spotweiss durch
den Korb gefallen« (III, CCCXCVII, 1).
Die Gebrüder Grimm schrieben seinerzeit: »...auf der Eifel wird
das körben als eine volksmäszige ehrenstrafe vollzogen an dem,
der nicht seine geliebte, sondern ein andres mädchen heiratet;
›man nimmt einen korb, dem der boden entnommen ist, und
die burschen ziehen das mädchen, die mädchen den jungen
mann, dem sein brautstück entgangen ist, durch denselben,
indem sie ihm den korb über den kopf stecken‹«.
Meyers Konversationslexikon leitet in der 4. Auflage (1885) die Redensart von der einst üblichen Rücksendung des »Corbeille de mariage« ab - dem Brautgeschenk, das der Bräutigam im verzierten Korb überreichte.
Karl Immermann (1796-1840) beschreibt einen westfälischen Brauch, wonach der liebestolle Freier eine Brautwerbung durch einen Mittelsmann vorab beim Brautvater andeuten ließ, der - wollte er ihn nicht zum Eidam - einen Korb so am Haus plazierte, daß der Bewerber schon von ferne sah, daß sein Werben aussichtslos sein würde. Er hatte »einen Korb bekommen« und konnte sich immerhin ohne Gesichtsverlust gleich wieder auf den Heimweg machen.
Eine ganz andere Deutung stellt auf einen niederdeutschen »Korbtanz« ab, bei dem eine Maid mit einem Korb im Schoß auf einem Stuhl sitzend einem Bewerber den Korb, dem anderen die Hand zum Tanze reicht.
Einen Kuppelpelz verdienenFür die Vermittlung eines Geschäfts wird eine Belohnung in Aussicht gestellt: Mittelalterliche Ehen wurden zumeist nach rein ökonomischen Grundsätzen geschlossen. Dabei stand dem »Kuppler«, dem Heiratsvermittler bei Erfolg eine Belohnung zu, ein Wertgegenstand, der nicht unbedingt ein »Kuppelpelz« sein mußte.
Einen langen Arm haben...Leute, die weitreichenden Einfluß auf andere haben Die Wendung geht möglicherweise auf den römischen Dichter Publius Ovidius Naso (43 a.C.-17) und sein drittes Werk »Epistulæ Heroidum« - eine Sammlung fiktiver Liebesbriefe mythischer Frauen - zurück. Helena, die Gemahlin des Königs Menelaos, fragt darin den geliebten Paris, der sie einst entführt und damit den Trojanischen Krieg verursacht hatte: »Weißt du wohl, oh Paris, daß Könige lange Arme haben?«
Einen Metzgersgang machen...wir, wenn jemand vergeblich irgendwo hingeht, dort keinen Erfolg hat. Die Wendung hat ihren Ursprung im 16. Jahrhundert, als die Metzger häufig erfolglos zu den Bauern aufs Land gingen, um Schlachtvieh zu kaufen. Nicht immer bekamen sie, was sie wollten und um nicht völlig umsonst gelaufen zu sein, bauten sie mit der Zeit ein Postwesen auf, womit sie sich als Boten etwas dazuverdienten. Sogar das »Posthorn« - ursprünglich ein Rinderhorn - sollen sie erfunden haben.
Einen Narren gefressen...haben wir an einem, den wir sehr mögen, kritiklos schätzen, von dem wir in geradezu lächerlicher Weise eingenommen sind. Dieser Wendung liegt die Vorstellung zugrunde, daß ein alberner Mensch einen kleinen Dämon leibhaftig in seinem Innern habe. Im 16./17. Jahrhundert schnitten Wunderdoktoren an sogenannten Schaugerüsten mittels Dampf Grillen und Würmer aus dem Kopf. Geisteskranken schnitt man den Bauch auf, um »Narren« herauszuholen. Thomas Murner (1475-1537), der in seinen Satiren Mißstände in der Kirche bekämpfte, erklärt 1512 in seiner »Narrenbeschwörung«, er wolle versuchen, »die narren von den lüten zu bringen«, in seiner »Mülle von Schwyndelßheym vnd Gredt Müllerin Jarzeit« schreibt er anno 1515: »Wer hohen zorn nit kan vergessen, der hat auch rohe narren fressen«. Hans Sachs (1494-1576) schrieb einen Schwank »Der Narrenfresser« und ein Fastnachtsspiel »Das Narrenschneiden«. Hierin schneidet ein Arzt dem Kranken die Narren der Hoffart, des Geizes, des Neides, der Unkeuschheit, der Völlerei, des Zorns, des Scheltens etc. aus dem Leib. Heute wird an den eigentlichen Sinn nicht mehr gedacht, man stellt eher fest, daß jemand in einen anderen »vernarrt« sei.
Einen Rochus auf jemanden haben...vor allem Leute im Ruhrgebiet und Rheinland, wenn sie auf jemanden wütend sind. Das Wort geht auf das jiddische »rauches« (Ärger, Zorn), eine Abwandlung des hebräischen »rogez« (Groll) zurück. Schon in jüdischen Bibeltexten findet sich »ragaz« (erzürnen) und »hitragez« (sich ärgern), im Jiddischen wurde daraus auch »er raugest (ärgert) sich« und Ende des 19. Jahrhunderts ging der Rochus dann über das Rotwelsche ins Hochdeutsche ein.
Einen Ruf wie Donnerhall haben...gelegentlich Leute, die einen ausgeprägten Ruf haben, nicht nur einfach bekannt, sondern berühmt-berüchtigt sind. In dem patriotischen Lied »Die Wacht am Rhein« reagiert der Dichter Max Schneckenburger (1818-49) auf die Rückforderung der Rheingrenze durch Frankreich anno 1840:
»Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!
Wer will des Stromes Hüter sein?«
Einen Sack Flöhe hüten...müssen ist eine sehr schwierige bis unmögliche Aufgabe, weil man die Biester mit bloßem Auge praktisch nicht sehen kann. Übertragen steht dieser Spruch aus dem 16. Jahrhundert oft für ausgelassen tobende Kinder oder für etwas, das so anstrengend ist, daß man es am liebsten gar nicht machen möchte.
Einen schlanken Fuß machen...sich Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen und vor einem Problem davonlaufen. Ursprünglich kam das vielleicht daher, daß der Fuß, wenn man ihn vom Boden abhebt, schlanker ist, als wenn man drauf steht.
Einen Schuß Leichtsinn im Blut haben...Leute, die unbekümmert leben und nicht an eventuelle Folgen ihres Tuns denken: Die Wendung geht auf die alte Vorstellung zurück, daß die Zusammensetzung der Körpersäfte maßgeblich für Temperament und Charakter eines Menschen verantwortlich sei. Der Grund für den Leichtsinn wird in der Beschaffenheit des Blutes gesucht - man selbst kann also eigentlich nichts dafür und wird sich voraussichtlich auch nicht ändern.
Einen Schuß machen...oft Jugendliche, die plötzlich innerhalb weniger Wochen ein ganzes Stück wachsen - mit einer Geschwindigkeit, die übertrieben an einen Schuß erinnert. Auch verschiedene Pflanzen zeigen oft dieses Verhalten.
Einen Sockenschuß haben...umgangssprachlich Leute, die nicht recht bei Verstand, etwas verrückt sind. Ursprünglich kommt der Begriff aber aus der Wäscherei: Seit der Erfindung der Waschmaschine quält uns eines der wohl größten Alltagsgeheimnisse unserer Zivilisation, warum immer mal wieder einzelne Socken ohne »Partner« übrigbleiben. Damit Waschmaschinen diese nicht laufend »fressen«, werden sie vor dem Waschgang an der Fußspitze leicht zusammengeheftet, um sie nach dem Waschen nicht mühselig sortieren zu müssen.
Einen Spleen haben...umgangssprachlich Exzentriker, die eine Marotte, eine »fixe Idee« pflegen, scheinbar ein bißchen verrückt sind. Das englische Wort für »Zorn, Wut, Rage« geht auf das griechische »splēn« zurück, was dort »Milz« heißt und noch im 18. Jahrhundert den verdrießlichen Gemütszustand bei einer Hypochondrie - einer Erkrankung dieses Organs - bezeichnete.
Einen Sprung in der Schüssel...sagen wir gemeinhin Menschen nach, von denen wir meinen, sie seien nicht recht bei Verstand, etwas verrückt. Diese Redewendung, die heute eher ungebräuchlich ist, dürfte sich ursprünglich noch auf eine Tasse bezogen haben - allerdings nicht wirklich auf das Trinkgefäß, sondern vielmehr übertragen von dem jiddischen »toshia«, das soviel wie »Verstand« bedeutet.
Einen Stein im Brett haben...gute Freunde, die einem immer zur Seite stehen. Einen ersten Beleg für diese Wendung findet man in Johannes Agricolas (1494-1566) »Sprichwörtersammlung« von 1529 unter »Ich hab eyn guten steyn im brette«: »Wer auff dem spill eynen gutten bund (= zwei Steine nebeneinander) im brette hatt, darüber ein ander sein steyne spillen muß, der hatt das spil halbs gewunnen. Also auch wer vor großen Herren und Rädten zu schaffen hatt vnd hatt yemand der sein sach trewlich fordert vnd treibet, der hat eynen gutten steyne im brette, einen gutten freundt, der ym zu seiner sache redt vnd hilffet«. Ursprung der Redensart ist also das »Puffspiel«, auch »Tricktrack«, verwandt mit dem heutigen »Backgammon«. Im Spiel hat derjenige einen guten »Stein im Brett«, der zwei nebeneinanderliegende Felder mit seinen Steinen belegt hält, da er so dem Mitspieler das Gewinnen erschwert. Verschiedene Spielregeln aus dem 13. Jahrhundert sind im »Libro de los juegos« (Buch der Spiele, auch Codex Alfonso) von Alfons X. »dem Weisen« (1221-84) zu finden.
Übrigens: Der umgangssprachliche Ausdruck »Puff« für das Freudenhaus leitet sich direkt vom Würfelwurf »Pasch« aus diesem Spiel ab, das in jenen Häusern einst gern gespielt wurde. Klingt ja auch besser, wenn man sich zum Würfeln verabredet...
Einen Steinwurf entfernt...ist laut Volksmund etwas in allernächster Nähe - ungefähr nur so weit weg, wie jemand einen handelsüblichen kleinen Findling werfen könnte. Ein dezidierter Umrechnungsfaktor in Meter oder Fuß ist nicht bekannt, aber laut Lukasevangelium verwendete schon Jesus in Gethsemane diese Entfernungsangabe: »Et ipse avulsus est ab eis quantum iactus est lapidis et positis genibus orabat« - »Vnd er reis sich von jnen bey einem Steinworff, vnd kniet nider, betet« (Lukas 22:41).
Einen Stiefel vertragen könnenTrinkgefäße in Form von Stiefeln sind schon seit dem 16. Jahrhundert belegt. Diese Form geht eventuell darauf zurück, daß einst wirklich aus Stiefeln getrunken wurde. Natürlich nicht aus Fußbekleidung - im »Ruodlieb«, dem ältesten Abenteuerroman deutscher Sprache (um 1030), werden die ledernen Weinbeutel scherzhaft »Stiefel« genannt. Es gibt auch einige Anekdoten, die besonders trinkfeste »Helden« beschreiben, die in einem Zug ganze Reiterstiefel leeren konnten. Ein Beispiel ist der »Trunk von Rothenburg«, durch den im Jahre 1631 der Bürgermeister seine Stadt vor Tillys Truppen rettete.
Einen Strauß mit jemandem ausfechten...heißt zwar, sich zu streiten, gegeneinander zu kämpfen, hier geht es aber weder um die großen Laufvögel, noch haut die Angebetete einem das edle Rosenbouquet um die Ohren. Der »Strauß« in dieser Wendung ist ein veralteter Ausdruck für »Streit, Zwist« und stammt vom mittelhochdt. »striuzen« (sträuben, streiten) ab. In der Form »Ein Scharmützel ausfechten« geht die Redensart zurück auf das italienische »scaramuccio« (kleines Gefecht, Plänkelei), meint aber genau dasselbe - man haut sich schlicht gegenseitig aufs Maul.
Einen Streit vom Zaun brechenDiese leichtsinnig und mutwillig provozierte Auseinandersetzung hat eigentlich nichts damit zu tun, daß irgendwer die erstbeste Zaunlatte an der Straße zur handfesten Klärung einer Angelegenheit benutzte, sondern erklärt sich aus dem Wort »Zaun«, das mit dem engl. »Town« verwandt ist. Dieses bezeichnet nicht das Hindernis, sondern das umschlossene Gebiet. Brach man also einen »Streit vom Zaun«, begann man ursprünglich eine Gebietsstreitigkeit.
Einen Strich durch die Rechnung machen...wir jemandem, dessen Absichten wir durchkreuzen, den wir an der Durchführung seiner Pläne hindern, seinen Erfolg zunichte machen: Eine Rechnung wurde einst als falsch oder als beglichen gekennzeichnet, indem man sie einfach durchstrich, mit einem Querstrich versah. Wer dem Wirt »einen Strich durch seine Rechnung« machte, erklärte damit die Bezahlung als hinfällig.
Eine andere Erklärung meint, daß man sich seine eigenen Chancen für einen Plan ausrechnet - denkt das Gegenüber allerdings weiter und streicht diese Berechnung, erzielt es ein neues, für sich selbst besseres Ergebnis.
Einen Tiefschlag einstecken...muß umgangssprachlich jemand, der eine folgenschwere Niederlage hinnehmen muß, der in seinem Selbstbewußtsein gekränkt, in seinen Erwartungen enttäuscht wird. Der Ausdruck stammt aus der Boxersprache für einen äußerst schmerzhaften Schlag oder Tritt unter die Gürtellinie.
Einen Toast ausbringen...stammt aus dem England des 19.Jahrhunderts, wo englische Lords ein Stück geröstetes Brot in den Wein gaben, damit dieser besser schmeckte. Daher bringt man noch heute einen Toast aus, wenn man auf etwas anstoßen will.
Einen Türken bauenEin Deutungsversuch basiert auf einem 1769 von Johann Wolfgang Ritter von Kempelen de Pázmánd (1734-1804) gebauten, vorgeblich mechanischen Schach-»Automaten«, der einen menschlichen Gegner, der die Figur bediente, verbarg. Ein Stich der »Illustrated London News« zeigte 1845 statt des Blicks auf die vorgegaukelte Mechanik den Türken am Schachbrett - in einer Hand einen Stab zum Bewegen der Spielfiguren. Der Automat, der um 1800 bei Tourneen durch Europa und Amerika für viel Aufsehen sorgte, verbrannte 1854 in einem Museum in Philadelphia.
Gegen diese Etymologie spricht das »Oxford English Dictionary«, das unter »Turk« »a human figure at which to practise shooting« (heute ein Pappkamerad) nebst Belegen, die bis 1569 zurückreichen, verzeichnet.
Der »Wahrig« nennt als weitere Quelle die Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals anno 1895: Ein Orchester soll anläßlich der Ankunft einer Delegation aus dem Osmanischen Reich mangels Noten für die Nationalhymne ersatzweise (wegen des Halbmondes in der Flagge) das deutsche Volkslied »Guter Mond, Du gehst so stille« gespielt haben. Selbst wenn diese Geschichte wahr sein sollte, so fand sie aber wohl doch zu spät statt, um Ursprung für die Wendung sein zu können.
Überdies gibt es Spekulationen, die die Wendung mit dem französischen »tête de turc« (wörtlich: Kopf des Türken, übertragen: Prügelknabe, Sündenbock) in Verbindung bringen.
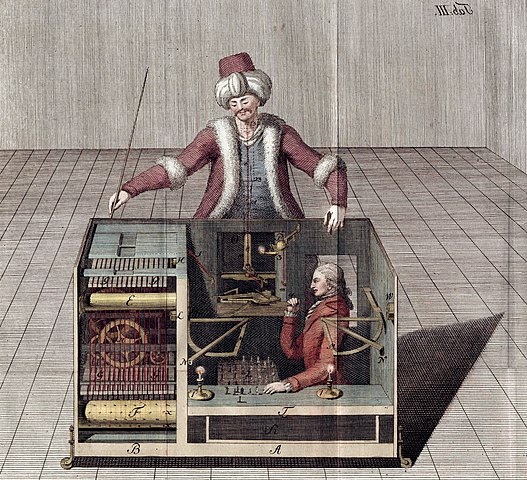
Der »Schachtürke«
Bild: wikimedia.org
Einen Vogel habenFrüher glaubte man, daß bei psychisch Kranken ein Vogel nebst Nest unter der Schädeldecke sitze und munter vor sich hinpiepe. Auch die Redewendung »Bei Dir piept's wohl!« hat diesen Ursprung.
Einen vom Pferd erzählen...uns manchmal andere, wenn sie Geschichten zum Besten geben, die man besser nicht glauben sollte: Beim Kampf um Troja hatten sich die Griechen in einem riesigen hölzernen Pferd versteckt. Ein Krieger erzählte den Trojanern, jenes Pferd sei ein Gottesopfer und alle Griechen seien längst nachhause gesegelt. Sie zogen das »Trojanische Pferd« in die Stadt und gingen unter.
Einen Zahn zulegen...konnte man früher, als die Menschen in Ihren Häusern auf offenem Feuer kochten, über dem ein Kessel aufgehängt war. Der Griff dieses Kessels hing an einer Metallstange, die mehrere Zähne besaß, damit man den Kessel höher oder tiefer über dem Feuer einrasten konnte. Kam der Mann abends hungrig nachhause, sagte er zur Hausfrau »Leg mal einen Zahn zu« und meinte damit, daß sie den Kessel tiefer über das Feuer hängen sollte, damit das Essen schneller fertig würde.
Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung des Automobils kam eine weitere Bedeutung dazu: Man bezog sich nunmehr auf eine Zahnstange, die zur Einstellung und Arretierung des damals üblichen Handgashebels diente und die Geschwindigkeit jeweils um eine Stufe erhöhte.
Einen zwitschernWer »einen zwitschert«, trinkt einen über den Durst, besäuft sich mal so richtig. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts bezieht sich die Redewendung auf die heitere Stimmung und lockere Zunge eines Zechers, der - beschwingt vom den Alkohol - lustig und fröhlich draufloszwitschert wie ein Vogel.
Einer für alle, alle für einenDas oft zitierte Motto, das wohl jeder aus dem Roman »Die drei Musketiere« von Alexandre Dumas (1802-70) kennt: Athos, Porthos und Aramis freunden sich mit dem Fechtkünstler d'Artagnan an, mit den Worten: »Tous pour un, un pour tous« schließen sie während vieler Abenteuer immer wieder ihre Reihen.
Einer trage des anderen Last...kommt mal wieder aus der Bibel: »Alter alterius onera portate et sic adimplebitis legem Christi«. - »Einer trage des andern Last, so werdet jr das gesetz Christi erfuellen«. heißt es in Galater 6.2
Einer wie der andere...trösten sich sogenannte »Beste Freundinnen« gern gegenseitig, wenn sie mal wieder von ihrem Lebensabschnittsgefährten verlassen worden sind. Im Neuen Testament der Bibel schreibt Paulus über sich und den urchristlichen Missionar Apollos: »Ego plantavi Apollo rigavit sed Deus incrementum dedit itaque neque qui plantat est aliquid neque qui rigat sed qui incrementum dat Deus qui plantat autem et qui rigat unum sunt unusquisque autem propriam mercedem accipiet secundum suum laborem« - »Jch habe gepflantzet, Apollo hat begossen. Aber Gott hat das gedeien gegeben. So ist nu weder der da pflantzet noch der da begeusset etwas sondern Gott der das gedeien gibt. Der aber pflantzet vnd der da begeusset ist einer wie der ander. Ein jglicher aber wird seinen Lohn empfahen nach seiner erbeit (1 Korinther 3:6-8).
EinfältigFrüher glaubte man, ein frommer, einfacher Mensch hätte eine glatte, nur einmal gefaltete Seele, während ein ungläubiger Mensch ein zweimal gefalteter, also ein »Zweifler« war.
Einfaltspinsel...mögen ja nur wenige Einfälle haben, eher beschränkt oder naiv sein - das Wort ist aber ein Kompositum aus »einfältig« (von schlichtem Geiste) und »Pinsel«. Bei diesem Schimpfwort aus der Studentensprache des 18. Jahrhunderts geht es aber nicht um das Malerwerkzeug: Das Wort ist zusammengewachsen aus »Pinn« (hölzerner Schuhnagel) und »Sul, Suwel« (Schusterahle); daraus entstand »Pinnsuhl, Pinsoul« für einen geizigen, niederträchtigen Zeitgenossen. Warum dies einst eine Berufsschelte für Schuster war, weiß heute allerdings niemand mehr...
Eingefleischter Junggeselle»Eingefleischt« ist eine Lehnübersetzung vom lateinischen »incarnatus« - »zu Fleisch geworden«. Ursprünglich wurde es nur für Christus, den fleischgewordenen Sohn Gottes benutzt, mittlerweile verwendet man es nur noch zur Beschreibung eines »unverbesserlich unverheirateten Mannes«.
Einkratzen...bezieht sich wohl auf Hunde und Katzen, die an der Kleidung kratzen, um um unsere Zuneigung zu buhlen, oder an der Tür, um eingelassen zu werden. Davon abgeleitet kratzen wir uns ein, wenn wir jemanden umwerben, einen Fehler wiedergutmachen oder auf Andere anziehend wirken wollen.
Einmal ist keinmal...sagt ein altes Sprichwort, das wir für kleine Laster und Fauxpas als Entschuldigung vorschieben. So schlimm wird es schon nicht kommen, wenn man einmal etwas Dummes macht, es ist halt nicht wirklich wichtig, kein großer Schaden zu befürchten. Auch wenn wir gerade etwas Schönes oder Besonderes erlebt haben, das wir nur zu gern noch einmal genießen wollen, ist diese Wendung beliebt: Erst durch die Wiederholung entdeckt man etwas in seiner ganzen Vielfalt und Schönheit, wird etwas zu dem, was es »eigentlich« sein soll, man achtet auf ganz andere Details, nur wenn man etwas mehrmals tut, bekommt man die nötige Übung und man kann es dann immer besser. Der Dichter Johann Peter Hebel (1760-1826) sagte einst: »Das ist das erlogenste und schlimmste unter allen Sprichwörtern, und wer es gemacht hat, der war ein schlechter Rechnungsmeister oder ein boshafter. Man kann meistens mit Wahrheit sagen: einmal ist zehnmal, und hundert- und tausendmal«. Auch der Essayist und Philosoph Walter Benjamin (1892-1940) wählte diese Losung zum Titel einer Besinnung über die Beziehung von Erwartung und Erfüllung in der Erotik aus. Aber nie vergessen: »Zweimal ist einmal zuviel«, vielleicht schon der Anfang einer Gewohnheit. Manche Dinge verlieren bald ihren Zauber und werden langweilig,
Eins auf den Deckel (aufs Dach) kriegen...umgangssprachlich Leute, die einen Fehler gemacht oder nicht ganz nach den Vorstellungen und Wünschen ihres privaten oder dienstlichen Vorgesetzten gehandelt haben: Heute wird so jemand wohl eher verbal zurechtgewiesen oder getadelt, früher bedeutete es tatsächlich, einen Schlag auf den Kopf zu bekommen. Das »Dach« wird hier im Sinne von »Schädeldecke« verwendet, jene wiederum pars pro toto für den Kopf. Der »Deckel« hingegen steht substituierend für den »Hut«, der üblicherweise auf dem Kopf sitzt und der körperlichen Züchtigung wohl auch nicht wirklich viel entgegenzusetzen hätte.
Eins, Zwei, Drei, im SauseschrittWir machen etwas, was uns Spaß macht und die Zeit verfliegt im »Sauseschritt« - vermeintlich viel schneller, als es zu erwarten wäre. Das Wort stammt vom Urvater des Comics, dem deutschen Dichter, Maler und Zeichner Wilhelm Busch (1852-1908) aus seiner Bildergeschichte »Julchen«:
»Einszweidrei im Sauseschritt!,
läuft die Zeit, wir laufen mit«.
...heißt es in der Lebengeschichte von Vater Knopp und Tochter Julia.
Einseifen...im Sinne von »jemanden betrügen, übervorteilen« kennt man aus der Gaunersprache Rotwelsch und leitet sich vom jiddischen »sewel« - Schmutz, Dreck, Kot - ab. Daraus entstand »beseibeln, besefeln« - mit Schmutz und Dreck einschmieren.
Eine andere Deutung stellt auf das Verhalten des Friseurs ab, der während des Einseifens unablässig auf seinen Kunden einredet.
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung...sagt das Sprichwort, wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Selbsterkenntnis, innere Einkehr, das begreifen eigener Unzulänglichkeiten ist oberste Voraussetzung, künftig etwas zu verändern und beim nächsten Mal besser zu machen.
Eintrichtern...geht auf den »Nürnberger Trichter« zurück, jener wiederum auf ein Poetiklehrbuch des Gründers des »Pegnesischen Blumenordens« und Nürnberger Dichters Georg Philipp Harsdörffer (1607-58), das unter dem Titel »Poetischer Trichter. Die Teutsche Dicht- und Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in VI Stunden einzugießen« 1647 in Nürnberg erschien. Durch dieses Werk wurde der »Nürnberger Trichter« bald zu einer scherzhaften Bezeichnung für ein (mechanisches) Lehrverfahren, mit dem man auch dem Dümmsten quasi mühelos Wissen »eintrichtern« kann.
In der Stadtbibliothek Nürnberg befindet sich die wohl älteste Darstellung eines Nürnberger Trichters. Auf einem Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert sind Männer abgebildet, die einem am Boden liegenden die Weisheit mit einem großen Trichter eingießen. Auf dem Werk sind alle möglichen Gegenstände zu erkennen, die in diesen Trichter hineingeschüttet werden sollen.
Das Wort ist aber auch schon in der Sprichwörtersammlung von Sebastian Franck (1499-1542) aus dem Jahr 1541 - damals allerdings noch ohne Bezug auf die Stadt Nürnberg - belegt.
Eisbein...hat verschiedene Namen: »Knöchle«, »Schweinsfüße«, »Schweinshaxen«, »Schweinebein«...
»Bein« nannte man früher den Knochen, vergleichbar mit dem englischen »bone«. Der erste Wortteil erklärt sich kurios: Im 17. Jahrhundert brachten holländische Einwanderer das Eislaufen nach Berlin. Sie benutzten für die Kufen Knochen aus den Hinterbeinen der Schweine und nannten sie »Eisbeine«. In Schweden waren solche Schlittschuhe noch lange als »isläggar« (Eisschenkel) bekannt. Theodor Storm erwähnte sie in einer Novelle.
Eiserne Reserve...nennen wir gemeinhin einen Vorrat für Notfall, einen Notgroschen für schlechte Zeiten. Während manche den Ursprung dieser sprichwörtlichen Redensart schon in den Kasematten mittelalterlicher Burgen sehen, in denen ein Vorrat an eisernen Kanonen und Kugeln vorgehalten wurde, meinen andere, der Ausdruck stamme aus dem Landserjargon des Ersten Weltkriegs und bezeichne den Proviant, die Konservendosen oder die Kekse in Blechschachteln, die als Teil des Sturmgepäcks nur für Notfälle gedacht waren. Wieder andere beziehen den Begriff »eisern« eher auf die Bedeutung »unerbittlich, rücksichtslos, notwendig«, in dem Sinne, daß Eisen als fast unverwüstlich galt. Eine weitere Deutung vermutet als Hintergrund die Verwendung eiserner oder auch eisenbeschlagener Truhen für die Aufbewahrung von Geld und Wertsachen.
Eiserner VorhangDer Begriff stammt ursprünglich aus der Theaterwelt, in der er einen feuerfesten Schutzvorhang, durch den in einem Brandfall Bühne und Zuschauerraum voneinander abgeschottet werden können, bezeichnet. Zum Schlagwort für die Grenzlinie, die das sowjetisch dominierte Ost- und Mitteleuropa vom amerikanisch dominierten Westeuropa trennte und die später in der Berliner Mauer sinnfälligen Ausdruck fand, wurde er durch Winston Churchill (1874-1965), als der in einer Rede am 5. März 1946 im Westminister College in Fulton (Missouri, USA), vom »Eisernen Vorhang« sprach, der nach dem 2. Weltkrieg »von Stettin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria« über Europa gezogen wurde.
Eisheilige...nennt man die drei Namenstage von Bischöfen und Märtyrern aus dem 4. und 5. Jahrhundert: Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai) und Bonifatius (14. Mai), regional auch noch Mamertus (11. Mai) und die kalte Sophie (15. Mai). Nach jahrhundertealten Erfahrungen und Beobachtungen von Bauern wird das milde Frühlingswetter erst danach stabil. Überraschende Kälteeinbrüche im Mai sind häufig, wobei man allerdings berücksichtigen muß, daß Papst Gregor XIII. anno 1582 den gregorianischen Kalender einführte. Da die Eisheiligen im Kalender statisch stehengeblieben sind, finden sie also eigentlich erst 11-12 Tage später, also vom 23.-27. Mai, statt.
ElbflorenzJohann Gottfried Herder (1744-1803) nannte 1802 in »Adratea - Kunstsammlungen in Dresden« die Stadt ein »Deutsches Florenz«. Mit der Zeit wurde daraus »Elb-Florenz«, wohl in Anlehnung an »Spree-Athen« (Berlin).
ElchtestDarüber lachte die Welt: Ein deutsches Auto - ein »Mercedes« gar - kippte in der Kurve einfach um. Der Begriff entstand, als am 21. Oktober 1997 eine »A-Klasse« bei einem Test im Land der Elche auf die Seite kippte und schließlich auf dem Dach liegenblieb. Der Fahrer kam ins Krankenhaus, der Ruf des kleinen Benz war restlos ruiniert: Statt von »Weltklasse« wurde hämisch von »Vält-Klasse«-Autos (schwedisch vältra: umkippen) gesprochen.
Eldorado...wurde ursprünglich entsprechend dem spanischen »El Dorado« (der Vergoldete) auf einen Menschen bezogen. Nach einem Bericht des englischen Seefahrers und Schriftstellers Sir Walter Raleigh (1552-1618) wurden in manchen Regionen Südamerikas die Häuptlinge jeden Morgen gebadet, von Kopf bis Fuß eingeölt und durch ein Schilfrohr mit Goldpuder bestäubt. Der Begriff wurde später auch auf die Regionen übertragen.
Heute bezeichnet »Eldorado« ein Gebiet, das ideale Verhältnisse bietet oder das sich jeder für die eigenen Sehnsüchte und Träume wünscht.
Elf Freunde müßt ihr seinBei dieser Fußballweisheit denkt man an den berühmten Trainer Sepp Herberger (1897-1977), aber das Zitat stammt aus anderer Quelle. In seinem Buch »Fußball: Theorie, Technik, Taktik« schrieb schon im Jahre 1919 der damalige Trainer von Tennis Borussia Berlin, Richard Girulatis: »Elf Freunde müßt ihr sein, um Siege zu erringen«. Es war das erste Lehrbuch für Fußball in Deutschland, und Girulatis (1878-1963) beschrieb darin die zentrale Bedeutung von Gemeinschaftssinn unter den Spielern und guter Stimmung im Team.
Elfenbein...rührt nicht von dem Glauben her, daß es sich um Knochen von Elfen handelt. Es ist aus einer Lautverschiebung entstanden. Vom altdeutschen »Helfantbein« (Elefantenknochen) wurde es über »Helfanbein« zu »Helfenbein«. Einer früheren Rechtschreibreform fiel dann das »H« zum Opfer.
ElfenbeinturmDer Marienkult des Mittelalters verwendete den Terminus in der Lauretanischen Litanei als Attribut der Mutter Jesu: Die Jungfrau Maria wurde zum »turris eburnea«, weil der Turm die Standhaftigkeit gegenüber dem Bösen und der Elefant als keusches Tier die Reinheit symbolisierte. Viele turmartige Aufbewahrungsgefäße aus Elfenbein für geweihte Hostien sind aus dieser Zeit überliefert. Daran knüpfte 1837 der französische Kritiker Charles-Augustin Sainte-Bœuf (1804-69) an, als er in seinen »Pensees d'aout« (August-Gedanken) den Dichter Alfred Comte de Vigny (1797-1863) als überlegenen Denker im Elfenbeinturm beschrieb. Von Sainte-Bœuf übernahmen Literaten wie Gabriele d'Annunzio, Oscar Wilde und Henry James das markante Wort.
Im Deutschen erschien es nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem in der Literaturkritik - nun in negativer Bedeutung als Vorwurf gegen eine elitäre, überzüchtete Form der Dichtkunst. Seither ist die Redewendung »Der sitzt im Elfenbeinturm« für einen weltfremden Zeitgenossen immer populärer geworden. Den Studenten der 68er kam sie gerade recht, um Professoren zu bespötteln, die sich mit dem Verweis auf Forschungsinteressen nicht um Tagespolitik und dringende Probleme kümmerten. Noch heute hört man den Satz häufig, wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, voran Künstler oder Wissenschaftler, als unnahbare hochmütige Einzelgänger erscheinen. Autor Peter Handke wehrte sich gegen solche Vorwürfe, indem er den Spieß umkehrte und in seinem 1972 verfaßten Bekenntnis »Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms« ein hohes Lied auf den literarischen Individualismus anstimmte.
ElferratDie Organisationszentrale des Karnevalsvereins wurde 1823 eingeführt, als die linksrheinischen Gebiete französisch besetzt waren. In der Karnevalszeit trug man wie die Franzosen Uniformen und hatte einen Bürgerrat, der aus 11 Personen bestand. Nach anderer Lesart steht die Elf für die französische Trias »Egalité, Liberté, Fraternité;«.
Elysium...nannte die griechische Mythologie ein vorhellenisches Paradies, ein Land des vollkommenen Friedens und der Glückseligkeit. In den Werken Homers lag Elysium äußersten Westen der Erde und war Aufenthaltsort großer Heroen, die ihre menschliche Natur behielten und Unsterblichkeit erlangt hatten. In diesem Land, wo Sorgen und Krankheiten unbekannt waren, konnten sie ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Schon bald galt Elysium als Wohnort der Seligen. Hier lebten die verstorbenen Helden in vollkommener Glückseligkeit, von Gras, Bäumen, sanftem Wind und rosarotem ewigem Licht umgeben.
In der römischen Mythologie war Elysium ein Teil der Unterwelt und den Tugendhaften nach dem Tod vorbehalten. Für manche war es lediglich ein vorläufiges Paradies. Am Rande seiner lieblichen grünen Wiesen floß die Lethe, der Fluß des Vergessens, aus dem alle Seelen, die im Himmel ins Leben zurückkehrten, trinken mußten.
Ende gut - alles gut...sagen wir, wenn eine Sache ein gutes Ende genommen hat, vorausgegangene Schwierigkeiten nicht mehr wichtig sind. »All's Well That Ends Well« ist ursprünglich der Titel eines Stückes von William Shakespeare (1564-1616) nach einer Novelle aus Giovanni Boccaccios (1313-75) Novellen »Decamerone«. Unter anderem hießt es dort: »Ende gut, alles gut: das Ziel beut Kronen! Wie auch der Lauf, das Ende wird ihn lohnen« (4.4, Helene). Die Liebe findet auch hier auf verschlungenen Pfaden letztlich zu ihrem Ziel.
Enfant terrible»Les enfants terribles« - »Das schreckliche Kind«, sinngemäß einen Familien- oder Bürgerschreck nannte der französische Karikaturist Paul Gavarni (1804-66) eine seiner komischen Bilderfolgen, in der Kinder den Erwachsenen in jedem Bild unangenehme Wahrheiten offenbaren. Als »enfant terrible« bezeichnet man heute einen Außenseiter oder Exzentriker, häufig im Bereich von Kunst, Kultur, Mode und Sport, der durch allzu große Offenheit Verlegenheit hervorruft.
EngelmacherinFrauen, die Abtreibungen bei anderen Frauen vornahmen.
EnteSchon bei dem deutschen Theologen und Reformator Martin Luther (1483-1546) heißt es: »So kömpts doch endlich dahin, das an stat des evangelii und seiner Auslegung widerumb von blaw Enten gepredigt wird«. Andere gehen davon aus, daß die Ente als unzuverlässige Brüterin bekannt sei, was ihr den schlechten Ruf einbrachte. Viel später, im 19. Jahrhundert kam eine französische Zeitung mit dem Titel »Le Canard Enchainee« (Die gefesselte Ente) auf. Wie dieser Titel motiviert ist, ist unklar, doch führt man den Ausdruck »Zeitungs-Ente« heute oft darauf zurück. Nach einer vierten Deutung kommt der Ausdruck von der englischen Abkürzung »N.T«., die für unbestätigte Berichte anstelle eines Agenturvermerks benutzt wurde. »N.T«. bedeutet eigentlich »not testified«, ursprünglich wohl einst lateinisch »non testatum«, spricht sich aber im Deutschen wie »En-Te«.
Entenschnabel...nannte man eine Schuhform, die im 15. Jahrhundert von den »Schnabelschuhen« zu den »Kuhmäulern« führte. Während die Schnabelschuhe eine extrem lange Spitze hatten, waren die der Entenschnäbel schon abgerundet.
EntlarvenWir finden heraus, was tatsächlich hinter jemandes Fassade steckt: Die »Larva«, im Lateinischen die »Maske«, kennt jeder vom Karneval. Bei Maskenbällen »entlarven« sich die Teilnehmer selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt und zeigen dann ihr »wahres Gesicht«.
Epikureer...sind Menschen, die nach dem bequemen und genußreichen Leben streben. Gemeint ist jedoch nicht die zügellose Sinneslust, sondern das Streben nach einem schönen Leben, gepaart mit Mäßigkeit, Selbstbeherrschung und Gelassenheit, um nicht nur in den Tag hineinzuleben, sondern ihn zu nutzen. Die Bezeichnung geht zurück auf den griechischen Philosophen Epikur (341-270 a.C.). Als Quellen für den Epikurismus dienen insbesondere die Schriften des römischen Dichters Lukrez (ca. 96-150) und der Dichter Vergil und Horaz.
Er hat's beniest...also muß es wahr sein, behaupten wir, wenn jemand eine undenkbare Sache erzählt und ein anderer dazu herzhaft niest. Das könnte daher kommen, daß der Niesende eine Kopfbewegung macht, als wenn er »Ja« sagen, es bestätigen wollte.
Er zählt die Häupter seiner Lieben...behaupten wir - abgeleitet von den Köpfen, die oft auf Münzen abgebildet sind - scherzhaft bei der Inspektion des Inhalts eines nicht sonderlich gut bestückten Geldbeutels oder wenn jemand die Vollzähligkeit einer Gruppe überprüft. Ursprünglich wird in Friedrich von Schillers (1759-1805) »Lied von der Glocke« von einer Brandkatastrophe berichtet: Ein Familienvater stellt - bei allen Verlusten, die er erlitten hat - beglückt fest, daß niemand seiner Angehörigen zu Schaden gekommen ist:
»Ein süßer Trost ist ihm geblieben:
Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! Ihm fehlt kein teures Haupt«...
Erbsenzähler...nennen wir umgangssprachlich kleinliche geizige Pedanten und Prinzipienreiter, die bildlich nichts anderes zu tun haben, als aus purer Langeweile oder Kontrollzwang festzustellen, wie viele Erbsen genau ein Pfund ergeben. Den Begriff verdanken wir einer Anekdote nach einem Zeitgenossen Karl Baedekers (1801-59): Beim Besteigen des Mailänder Doms soll der Westfale Karl Gisbert Friedrich Freiherr von Vincke (1813-92) anno 1847 den pingeligen Verleger dabei ertappt haben, wie jener alle 20 Stufen eine trockene Erbse von der Westen- in die Hosentasche steckte, um später penibel die Anzahl für seinen Reiseführer berechnen zu können. Jener Genauigkeit verdankt Baedeker wohl auch seine Verewigung in Jacques Offenbachs (1819-80) populärer Operette »La Vie Parisienne«, in der es heißt: »Es irren Könige und Minister, doch Baedeker - unfehlbar ist er«.
Erdbeerkörbchen...nannte man einst Cabrios vom Schlage eines VW Golf I oder Opel Kadett, die zur Versteifung und Überrollschutz einen Bügel quer über's Auto hatten. Der erinnerte in seinem Aussehen sehr an den Henkel eines Spankorbes.
ErgatternDieses Wort für »sich etwas Seltenes, Knappes mit List und Tücke, viel Ausdauer, Glück und Mühe verschaffen« stammt schon aus dem Mittelalter: Das »fahrende Volk«, Bettler oder sonstwie »unehrliche« Leute durften einen Gutshof nicht betreten. Sie mußten draußen vor dem Tor bleiben und konnten so weder Almosen empfangen, noch ihre Geschäfte tätigen - es sei denn, es wurde ihnen etwas durch bzw. über das Gatter gereicht.
Erika & Max Mustermann...sind fiktive Personen, die als Beispielnamen in Formularen und Datenbanken verbreitet werden. Ihre Lebensdaten wurden von der Bundesregierung verwendet, als 1982 der Öffentlichkeit der maschinenlesbare Personalausweis vorgeführt wurde. Seitdem sind die »Durchschnittsdeutschen« neben den weit älteren »Otto Normalverbraucher« und »Lieschen Müller« die meistzitierten Personen im deutschen Sprachraum. Erikas virtueller Gatte heißt Max Mustermann, ebenso wie oft ihr Sohn und Bruder. Ihr Vater hieß allerdings nicht Mustermann, sondern Franz-Xaver Gabler...
Erlaubt ist, was gefällt...wußte Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) in »Torquato Tasso«: Tasso liebt die Prinzessin - seine Liebeserklärung gipfelt in dem Satz »Erlaubt ist, was gefällt«. Zu seinem Leidwesen weist ihn die Prinzessin in seine Schranken: »Erlaubt ist, was sich ziemt«. Doch ist nicht alles verloren... Was allgemein Gefallen findet, kann sich über vorgegebene Normen hinwegsetzen.
Erlkönig...ist eine gängige Bezeichnung für automobile Prototypen, die vom Hersteller noch geheimgehalten werden. Der Name geht auf die berühmte Ballade von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zurück und wurde zunächst von den Journalisten Heinz-Ulrich Wieselmann und Werner Oswald in der »Auto, Motor und Sport« verwendet. Ab Heft 15 erschienen eine Zeitlang in jeder Ausgabe ein paar Bilder mit je einem kleinen Achtzeiler im Stil des Erlkönig-Poems. Erlkönig Nummer Eins war am 19. Juli 1952 der Mercedes Benz 180 mit folgender Bildunterschrift:
»Wer fährt da so rasch durch Regen und Wind?
Ist es ein Straßenkreuzer von drüben,
der nur im Umfang zurückgeblieben
oder gar Daimlers jüngstes Kind?
Der stille Betrachter wär gar nicht verwundert,
wenn jenes durchgreifend neue Modell,
das selbst dem Fotografen zu schnell,
nichts anderes wär als der Sohn vom ›Dreihundert‹«.
Ernst ist das Leben, heiter die KunstDiese Erkenntnis verdanken wir dem deutschen Dichter und Dramatiker Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) und seinem Prolog zu Wallensteins Lager. Am Ende heißt es dort:
»Des Tanzes freie Göttin und Gesangs,
Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel,
Bescheiden wieder fordert - tadelt's nicht!
Ja, danket ihr's, daß sie das düstre Bild
Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst
Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft,
Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein
Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt;
Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst«.
Erpicht...sind wir auf etwas, von dem wir nicht lassen können, auf das wir nachgerade versessen sind. Das hat ursprünglich mit dem klebrigen »Pech« zu tun, das der Vogelfänger auf seine Leimrute strich. Singvögel, die sich darauf niederließen, waren »verpicht« - sie kamen nicht mehr los.
Erschossen...fühlen wir uns gelegentlich, wenn wir überanstrengt, völlig erschöpft, am Ende unserer Kräfte sind. Ursprünglich waren wir »erschossen wie Robert Blum« (1807-48), ein Leipziger Buchhändler und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, der während des Oktoberaufstands 1848 in die Barrikadenkämpfe in Wien geriet und daraufhin standrechtlich erschossen wurde.
Erst die Piepe in Brand und dann das Pferd aus dem Graben...erklärt ein alter Bauernspruch, daß wir besser nichts überstürzen, sondern zuerst in Ruhe überlegen und erst dann handeln sollten, wenn wir einen guten Plan oder ggf. den nötigen Abstand zu einer Sache haben. Erst wenn wir Argument und Kritik ordentlich abgewogen haben, können wir richtig handeln.
Erst kommt das Fressen, dann die Moral...glaubt so mancher Manager und Politiker und schielt lieber zunächst nach kurzfristigem Erfolg und satten Boni, statt sich weiter um seine eigentliche Aufgabe zu scheren. Das stellte auch schon Bertolt Brecht (1898-1956) im Finale des 2. Aktes seiner »Dreigroschenoper« fest, wo er Mackie Messer und Jenny in der »Ballade über die Frage: ›Wovon lebt der Mensch?‹« singen ließ:
»Ihr Herrn, die ihr uns lehrt, wie man brav leben
Und Sünd und Missetat vermeiden kann
Zuerst müßt ihr uns was zu fressen geben
Dann könnt ihr reden: damit fängt es an.
Ihr, die euren Wanst und unsre Bravheit liebt
Das eine wisset ein für allemal:
Wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Erst muß es möglich sein auch armen Leuten
Vom großen Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden«...
Erst wenn der letzte Baum gefällt......der letzte Fluß vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen feststellen, daß man Geld nicht essen kann, heißt ein in der Umweltbewegung als »Weissagung der Cree« bekannter Spruch, der zumindest in dieser Form allerdings nicht indianischen Ursprungs ist. Häuptling Seattle (um 1786-1866) vom Stamme der Suquamish soll 1854 vor Isaac Ingalls Stevens, Gouverneur des Washington-Territoriums, immerhin so ähnlich gesagt haben: »Und wenn der letzte rote Mann von der Erde verschwunden und die Erinnerung des weißen Mannes an ihn zur Legende geworden ist, dann werden diese Gestade übervoll sein von den unsichtbaren Toten meines Stammes, dann wimmeln sie von den wiederkehrenden Scharen, die einst dieses Land bevölkerten und es immer noch lieben«. Eine andere Version kommt in einer Legende vor, die die amerikanischen Geographen William Willoya und Vinson Brown 1962 als »Prophezeiung der Hopi« veröffentlichten, endet aber auch nicht mit der Mahnung an die menschliche Gier, sondern mit dem Erscheinen einer Armee von Regenbogenkriegern: »Wenn die Erde verwüstet wurde und die Tiere sterben, wird ein neuer Stamm auf die Welt kommen, der aus Menschen vieler Farben, Klassen und Glaubensrichtungen bestehen wird. Sie werden durch ihre Taten die Erde wieder grün machen und Krieger des Regenbogens genannt werden«.
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt...sagen wir, wenn es mal wieder ganz anders lief, eine Sache sich anders entwickelt hat, als wir vorher geplant und gedacht hatten. Dieses Zitat stammt - wohl angelehnt an Wilhelm Buschs Bildergeschichte »Plisch und Plum«: »Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt« - von dem deutschen Schriftsteller, Film- und Rundfunkautoren Alexander Spoerl (1917-78).
Es fällt mir wie Schuppen von den Augen...sagen wir, wenn wir plötzlich klarsehen und die Lösung eines Problems erkennen. Das Synonym geht auf die Apostelgeschichte des Lukas (9.18) aus dem Neuen Testament zurück. Saulus von Tarsus wurde durch den Jünger Ananias von seiner Blindheit geheilt: »Et confestim ceciderunt ab oculis eius tamquam squamæ et visum recepit et surgens baptizatus est« - »Vnd also bald fiel es von seinen augen, wie Schupen, vnd ward wider sehend«. Daraufhin ließ sich Saulus als Christ taufen, nahm den Namen Paulus an und wurde neben Simon Petrus einer der wichtigsten Apostel. Heute fällt es manchem - leicht abgewandelt - auch schonmal »wie Schuppen aus den Haaren«...
Es frißt kein Brot...sagen wir von Dingen, die eigentlich für uns völlig nutzlos sind, nur herumliegen, von denen wir uns aber dennoch nicht trennen können. Immerhin »frist es kein Brot«, es verursacht auch keine weiteren Kosten oder Mühen, also mag es denn liegenbleiben.
Es geht aus wie das Hornberger SchießenDer Legende nach kündigte anno 1564 der Herzog von Württemberg einen Besuch im Kinzigtal an, wozu sich die Hornberger, völlig aus dem Häuschen, gehörig Mut antranken. Derweil saß Nachtwächter Läuble auf dem Turm, die Ankunft des Fürsten anzukündigen, um seine Hoheit mit zünftigem Kanonensalut zu beeindrucken. Doch der wackere Späher gab dreimal Fehlalarm: Erst donnerten die Kanonen für eine Viehherde, dann für einen Händlerkarren, zuletzt für eine Postkutsche... Als endlich der Landesherr vorfuhr, tönte ihm nur noch ein schneidiges »Piff-Paff« aus gut geölten Männerkehlen entgegen, denn - so reimt es Erwin Leisinger - »das Pulver ging aus zur schönsten Stund', sodaß man nicht mehr schießen kunnt!« Der Fürst reagierte zunächst ungnädig, als ihn die beschwipsten Hornberger aufgeklärt hatten, lachte er Tränen. Über den wahren Ursprung der Redensart gibt es viele Erklärungsversuche; in Hornberg selbst weiß man ihn nichtmal zuverlässig nachzuweisen. Die Frankfurter Zeitung, № 122, meinte 1872: »In neuerer Zeit ist nun der Badischen Landeszeitung eine, wie sie sich nennt, authentische Quelle zugegangen, welche folgendermaßen lautet: »Zwischen Hornberg und Villingen bestand in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine Eifersucht, die ihren Ausdruck vorzugsweise in der Anmaßung eines Hoheitsrechtes von Seiten der letztgenannten Stadt über das damals gut Württembergische Hornberg hatte. Aus Anlaß eines Tötungsfalles fielen nun die Villinger mit 50 Mann Bewaffneter in das Hornberger Gebiet ein, angeblich, um nach dem Täter zu fahnden, in Wahrheit aber, um an der unbotmäßigen Nachbargemeinde einmal ihren Groll auszulassen. Als sich die sonst friedliebenden Hornberger Bürger von dem ersten Schrecken über diesen unverhofften Besuch erholt hatten, verfügte sich zunächst eine Abordnung nach Villingen, um dem dortigen Bürgermeister eine schriftlich abgefaßte Rechtsverwahrung zu behändigen und wohl auch Genugtuung zu verlangen. Nach anfänglichem Weigern nahm zwar der Bürgermeister das Dokument »aus schuldigem Respekt vor der fürstlichen Herrschaft« zu Händen, erklärte aber, die Entscheidung in der Sache selbst dem Gemeinderat anheimstellen zu müssen. Da diese, wie es scheint, ad acta lautete, so wurde nun andererseits beschlossen, den Einfall und der darin nach Ansicht der beleidigten Stadt gelegenen Besitzstammung einen ebenbürtigen »actum contrarium« in der Weise entgegenzustellen, daß man mit Aufbietung einer dreifachen Macht, verstärkt durch 50 Pferde sowie eine Anzahl Kinder (letztere als lebendige Beweisstücke in perpetuam memoriam dessen, was nun geschah), in das Villinger Gebiet rückte und hierselbst mit drei »Salven« sein entrüstetes Rechtsbewußtsein zum sprechendsten Ausdruck brachte. Über den ganzen Hergang wurde dann an die herzogliche Regierung umständlich berichtet und am Schlusse unter Berechnung der Kosten des Auszugs und des verschossenen Pulvers die Anfrage gestellt, »ob nicht aus der Kellerei des Ober-Amtmanns an die beteiligten Mannschaften ein den damaligen Zeitverhältnissen entsprechendes Quantum Wein nebst Brot auf ärarische Kosten verabreicht werden soll«? Auf diese Anfrage warten die Bürger Hornbergs bis heut noch auf Antwort; sie sind indes dadurch viel berühmter geworden, als es bei einer Kneiperei in der Kellerei des Oberamtmanns möglich gewesen wäre«.
Es geht den Menschen wie den Leuten...sagen wir ironisch, wenn jemandem, der so gar nicht damit gerechnet hat, ein vermeintliches Mißgeschick widerfährt, das für uns ganz selbstverständliches Tagesgeschäft ist. Die »Menschen« und die »Leute« sind zwei Synonyme für ein und dieselbe Personengruppe - was viele Tag für Tag begleitet, kann durchaus auch mal jemanden treffen, der das eigentlich nicht gewohnt ist.
Es geht um die Wurst...wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, wir uns für eine Sache besonders einsetzen: Diese Wendung bezieht sich ursprünglich wohl auf volkstümliche Wettkämpfe wie »Wurstschnappen«, bei denen tatsächlich eine Wurst zu gewinnen war - für arme Leute sicher ein großer Erfolg.
Schon Homer sprach in seiner »Odyssee« über »Wurstkämpfe« der Griechen. Im 18. Gesang geht es sprichwörtlich »um die Wurst«, den Sieg in einem Wettkampf: Durch viele Irrfahrten ermüdet, kehrt Odysseus heim nach Ithaka. Damit man ihn nicht zu früh erkennt, hat ihn Göttin Athene als Bettler verkleidet. Irons, ein weiterer Bettler, fängt Streit mit ihm an, zum Zweikampf scharen sich die Menschenmassen zusammen:
»Aber Eupeithes' Sohn Antinoos sprach zur Versammlung:
Höret, was ich euch sage, ihr edelmütigen Freier!
Hier sind Ziegenmagen, mit Fett und Blute gefüllet,
Die wir zum Abendschmaus auf glühende Kohlen geleget.
Wer nun am tapfersten kämpft und seinen Gegner besieget,
Dieser wähle sich selbst die beste der bratenden Würste.
Künftig find er auch immer an unserem Mahle sein Anteil,
Und kein anderer Bettler soll diese Schwelle betreten.« (686)
Es geschehen noch Zeichen und Wunder...tun wir unsere Freude und Verwunderung kund, daß etwas Unerwartetes geschehen ist. Das Wort geht auf den ersten Teil von Friedrich von Schillers (1759-1805) Wallenstein-Trilogie zurück: In »Wallensteins Lager« heißt es im 8. Auftritt:
»Es ist eine Zeit der Tränen und Not,
Am Himmel geschehen Zeichen und Wunder,
Und aus den Wolken, blutigrot,
Hängt der Herrgott den Kriegsmantel runter«.
Der Kapuziner, der diese Worte spricht, bezieht sich dabei auf den Exodus des Alten Testaments, wo - neben zahlreichen anderen Bibelstellen - auch schon von »Zeichen und Wundern« die Rede ist, die Gott aber erst den Ägyptern antun will: »Sed ego indurabo cor eius et multiplicabo signa et ostenta mea in terra Ægypti« - »Aber ich wil Pharao hertz verherten, das ich meiner Zeichen vnd Wunder viel thu in Egyptenland« (2 Mose 7.3).
Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf Erden......als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio. Diese Worte sagt Hamlet, Prinz von Dänemark in der gleichnamigen Tragödie von William Shakespeare (1564-1616) zu seinem Freund, nachdem ihm bei der Nachtwache auf Schloß Elsinore der Geist seines ermordeten Vaters erschienen war und ihm eröffnet hatte, daß der König von dessen Bruder Claudius ermordet worden war, der dem im Garten Schlafenden Gift ins Ohr geschüttet habe. Der Geist des alten Hamlet nimmt seinem Sohn das Versprechen ab, den Mord zu sühnen, die Mutter aber dabei zu schonen. Danach bekundet Hamlet seinem Freund im englischen Original: »There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in our philosophy«. (1. Akt, 5. Szene, 167) Heute gebrauchen wir dieses Hamlet-Zitat gelegentlich, wenn außergewöhnliche Dinge geschehen, die wir uns nicht rational erklären können.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es...bringt der scharfsinnige Schriftsteller, Drehbuchautor und Kabarettist Erich Kästner (1899-1974) einst schlicht und realitätsnah wie kaum ein Anderer die Quintessenz seiner Lebensphilosophie auf den Punkt. Gute Taten sind nur dann etwas wert, wenn man sie auch tatsächlich tut und nicht nur davon redet. Das Epigramm »Moral«, sein wohl kürzestes Gedicht, das er in dem Taschenbuch »Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke« 1936 in Zürich veröffentlicht, erteilt dem passiv- lethargischen Pseudomoralismus eine klare Absage.
Es gibt sone und solche...Menschen, die ganz einfach verschieden sind. Ursprünglich stammt die Redensart aus einer der über 100 Possen des Berliner Lokalpoeten Hermann Salingré (1833-79) und lautete vollständig: »Et jibt sonne, und et jibt solche. Denn jibt ooch no andre - und det sind de Schlimmsten«.
Es gibt viel zu tun. Packen wir's an...ermuntert uns der Chef gern mal zu Höchstleistungen, meint eigentlich: »...fangt schon mal an« und wir wissen: »...warten wir's ab«. Diese Redewendung fußt auf einem Werbespruch der Firma Esso, den Hartmut Müller-Trollius von der Hamburger Agentur McCann-Erickson 1974 kreierte, als man sich in den Nachwehen des arabischen Ölembargos mit der Endlichkeit der Ölvorkommen und der Bedeutung von Energieeinsparung zu beschäftigen begann. Man wollte unabhängig werden vom Öl in dieser Zeit und neue Energiequellen nutzen. Wirklich gelungen ist das indes bis heute nicht...
Es gibt viele bunte Hunde, die Pudel heißen...erklären wir, wenn wir jemanden verwechselt haben - ganz fest glauben, ihn erkannt zu haben und er es dann doch nicht ist. Die Wendung fußt darauf, daß mancher »bekannt wie ein bunter Hund« ist, es aber immer wieder mal einen Doppelgänger oder eben schlicht eine Verwechslung geben kann.
Es hat nicht sollen sein...rufen wir manchmal resignierend aus, wenn eine Hoffnung sich nicht erfüllt. Dieses Zitat beinhaltet die Vorstellung von der Vorbestimmtheit des menschlichen Schicksals und geht zurück auf die humoristische Verserzählung »Der Trompeter von Säckingen«, in der der badische Schriftsteller Joseph Victor von Scheffel (1826-86) im Jahre 1854 zum den Abschied von einer geliebten Frau am Ende jeder der drei Strophen sagte: »Behüt Dich Gott! Es wär zu schön gewesen. Behüt Dich Gott! Es hat nicht sollen sein«.
Es irrt der Mensch so lang er strebtDiese Feststellung geht auf den Dichter, Dramatiker, Naturwissenschaftler, Kunsttheoretiker und Staatsmann Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) und sein wohl wichtigstes Werk »Faust. Der Tragödie erster Teil« zurück. Dort heißt es im »Prolog im Himmel« in Zeile 317:
»So lang' er auf der Erde lebt,
So lange sey dir's nicht verboten.
Es irrt der Mensch so lang er strebt«.
Es ist allerhöchste Eisenbahn...erklären wir, wenn etwas ist sehr eilig, sehr dringlich ist.
Die Redensart stammt aus dem Stück »Ein Heiratsantrag in der Niederwallstraße« des Berliner Volksdichters Georg Adolf Glaßbrenner (1810-76) aus dem Jahre 1847: Der arg zerstreute Briefträger Bornike will um die Hand der Tochter des Malers Kleisch bitten. Er ist über die unerwartete Höhe der Mitgift seiner Auserwählten derart erfreut, daß er vergißt, rechtzeitig die Briefe des Leipziger Postzuges abzuholen. Am Ende der Szene bricht der Briefträger urplötzlich auf, weil er die Post aus Leipzig, die schon im Postamt auf ihn wartet, noch austragen muß. Beim Weggehen verwechselt er in seiner Aufregung die Wörter »Zeit« und »Eisenbahn« und sagt: »Es ist die allerhöchste Eisenbahn, die Zeit ist schon vor drei Stunden angekommen«.
Es ist ein Kreuz...leitet sich vom Tode Christi am Kreuz ab. Bei den Römern galt die Kreuzigung als schändlichste Form der Todesstrafe. So wurde das Kreuz schon früh zum allgemeinen Symbol der schweren Last und des Leidens, das man zu tragen hat.
Es ist eine alte Geschichte... zitieren wir gelegentlich, wenn eine Liebesbeziehung schmerzlich gescheitert ist, den Anfang der dritten Strophe des 39. Gedichts aus Heinrich Heines (1797-1856) »Lyrischem Intermezzo«.
In dem Gedicht wird die unglückliche Liebe eines jungen Mannes zu einem Mädchen beschrieben, das aber einen anderen liebt:
»Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen heiratet aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei«.
Es ist nicht alles Gold, was glänztNicht alles, was schön aussieht, ist auch wirklich gut. Ursprünglich kommt der Spruch wohl aus dem »Rolandslied«, einem 4002 Verse umfassenden altfränkischen Versepos über Karl den Großen (748-814) und das heldenhafte Ende Rolands, das um 1075-1110 entstand. Dort heißt es:
»Er iruolte daz altsprochene wort;
ia ist gescrieben dort:
›under sconem schade luzet,
iz en ist nicht allez golt daz da glizzit‹«.
(Vers 1956-1959, übersetzt: Er [der verräterische Genelun] machte das alte Sprichwort wahr; es steht ja doch geschrieben dort: ›Unter Schönem lauert Gefahr; es ist nicht alles Gold, was glänzt‹.
Der Prediger und Schriftsteller Abraham a Sancta Clara (1644-1709) schrieb anno 1695 in »Judas der Erzschelm« ganz ähnlich: »So ist dann nit alles Gold, was glänzet«, auch in William Shakespeares (1564-1616) »Kaufmann von Venedig« heißt es: »Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist«, in Friedrich Hebbels »Tagebücher, 3.9.1836« lesen wir: »Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber es glänzt auch nicht alles was Gold ist« und natürlich darf auch der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) nicht fehlen: »Nicht ist alles Gold, was gleißt, Glück nicht alles, was so heißt, nicht alles Freude, was so scheint. Damit hab ich gar manches gemeint«. (Gedichte, Ausgabe letzter Hand. 1827).
Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei...heißt es im Alten Testament der Bibel über »Die Erschaffung des Weibes«: »Dixit quoque Dominus Deus non est bonum esse hominem solum faciamus ei adiutorium similem sui« - »Vnd Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut das der Mensch allein sey. Jch wil jm ein Gehülffen machen, die vmb jn sey«. (Genesis 2.18)
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) interpretierte das Bibelzitat so: »Es ist nicht gut, daß der Mensch alleine sei, und besonders nicht, daß er alleine arbeite; vielmehr bedarf er der Teilnahme und Anregung, wenn etwas gelingen soll«.
Der Mensch ist eben ein soziales Wesen. Auch wenn manche behaupten, es käme ihnen nur so vor: Verheiratete Männer leben (statistisch) tatsächlich länger als Singles...
Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben...wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt«. Wilhelm Tell, schweizerischer Freiheitskämpfer und Tyrannenmörder aus dem Dorf Bürglen im Kanton Uri, der an der Wende zum 14. Jahrhundert gelebt haben soll, sagt diese Worte kurz vor dem Attentat auf den Langvogt Gessler in der hohlen Gasse bei Küssnacht im Gespräch mit dem Flurschütz Stüssi im nach ihm benannten Bühnenwerk (3. Szene, 4. Akt) von Friedrich von Schiller (1759-1805). Roland Kaiser verwendete das Zitat 1984 für einen Schlagertext.
Es knistert im GebälkManchmal läuft es nicht richtig rund in der Gemeinschaft, der große Knall steht kurz bevor: Alte Holzhäuser unter Belastung durch Sturm oder Schnee machen zuweilen seltsam knisternde und knarrende Geräusche. Das Holz arbeitet, die Belastung steigt, die Töne werden immer lauter - bis das Haus einstürzt. Die Redensart könnte aber auch der Sprache der Bergleute entstammen: Das Knistern der Holzausbauten in der Grube bedeutete heftigen Gesteinsdruck, also höchste Gefahr.
Es kräht kein Hahn danach...erinnert an die Opferbräuche der alten Griechen und Römer: Von schweren Krankheiten Genesene opferten dem Æskulap gewöhnlich einen Hahn, der durch sein Krähen gleichsam die Genesung bekanntmachte. Mancher, der von der Wiederherstellung des Kranken nichts gehört hatte, wurde so aufmerksam gemacht, erkundigte sich danach und sprach gelegentlich davon. Im Neuen Testament (Matthäus 26.34) hat der Hahn Laut gegeben: »Ait illi Iesus amen dico tibi quia in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis« oder wie es Luther übersetzte »Jhesus sprach zu jm, Warlich ich sage dir, Jn dieser nacht, ehe der Hane krehet, wirstu mich drey mal verleugnen«. Es kam, wie es kommen mußte - der Menschensohn ward seinen Häschern übergeben, worauf sein Jünger tatsächlich bestreitet, daß er je etwas mit ihm zu tun gehabt habe: »Tunc coepit detestari et iurare quia non novisset hominem et continuo gallus cantavit et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat priusquam gallus cantet ter me negabis et egressus foras ploravit amare« - »Da hub er an, sich zu verfluchen vnd schweren, Jch kenne des Menschen nicht. Vnd als bald krehet der Hane. Da dachte Petrus an die wort Jhesu, da er zu jm sagte, Ehe der Hane krehen wird, wirstu mich drey mal verleugnen. Vnd gieng heraus, vnd weinet bitterlich«. (Matthäus 26,74f) Seither thront das Federvieh auf den Türmen unzähliger christlicher Gotteshäuser und mahnt so zu Treue, Umkehr und Wachsamkeit...
Es läppert sich zusammenEs soll im 18. Jahrhundert zu Leipzig einen Herrn Leppert, Verwalter der Salzeinkünfte des sächsischen Staates gegeben haben. Zuvor allerdings hatte jener ein unstetes, abenteuerliches Leben geführt - als Kurier eines Grafen, Hofnarr August des Starken und »Lustiger Rath« beim Grafen Brühl. Später wanderte er als Direktor einer Schauspielertruppe von Schloß zu Schloß. Sein Honorar erhielt er nie sofort in bar, sondern (wie wir heute sagen) in Raten. Leppert nannte das »läppern«, machte trotzdem ein Vermögen dabei, denn mit den Jahren »läppert es sich zusammen«.
Es liegt was in der Luft...wir können es ganz deutlich spüren oder auch befürchten: Es kündigt sich diffus etwas an, wir haben schon eine Vorahnung davon, die Umgebung erscheint so merkwürdig, irgendwas geschieht, aber wir durchschauen es - noch - nicht. Bully Buhlan (1924-82) und Mona Baptiste (1928-93) sangen in dem Musikfilm »Fräulein vom Amt« im Jahre 1954:
»Mir ist so komisch zumute,
Ich ahne und vermute:
Es liegt was in der Luft,
Ein ganz besond'rer Duft,
Der liegt heut in der Luft.
Das ist kein Alltag, so trübe und grau.
Das ist ein Tag wie der Frühling so blau.
Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt,
Daß noch was passiert.
Es liegt was in der Luft...
Ich könnte weinen und lachen
Und lauter Unsinn machen.
Es liegt was in der Luft...
Es muß nicht immer Kaviar sein...wenn man mal liebe Gäste bewirten will. Meist versucht man, ihnen etwas ganz »Besonderes« aufzutischen - bei einer größeren Party sättigen jedoch oft auch einfache Gerichte die Menge.
Die Wendung war 1960 Titel eines berühmten Romans von Johannes Mario Simmel (1924-2009), in dem der Geheimagent wider Willen Thomas Lieven sein Faible für Abenteuer, Frauen und das Kochen auslebt. Seine Rezepte kann man im Buch nachlesen.
Es müßte schon mit dem Teufel zugehenDie Wendung aus dem 18. Jahrhundert meint, daß schon etwas äußerst unwahrscheinliches, ein Wunder geschehen müßte, was der natürlichen Ordnung der Welt zu widersprechen scheint und spielt auf den Teufelspakt verschiedener Sagen an.
Es regnet Bindfäden...behaupten wir bei einem anhaltenden kräftigen Landregen. Wenn es nahezu windstill ist, fallen die Tropfen senkrecht nach unten und sehen aus, wie an einer Schnur aufgefädelt - man kann sie nicht auseinanderhalten. Steigerungen lassen es gelegentlich auch »wie aus Eimern schütten« oder »in Strömen gießen« und ganz selten regnet's gar »Eisenbahnschienen senkrecht«.
Es regnet Katzen und Hunde...behauptet der Engländer und meint eigentlich, daß es »in Strömen gießt«, »Bindfäden regnet« oder »schüttet wie aus Eimern«. Es klingt ziemlich unwahrscheinlich, daß dem Inselbewohner jemals Katzen oder Hunde auf den Kopf gefallen sind und in der Tat geht diese Redensart wohl auf den lateinischen Ausdruck »cata doxas« zurück, was man mit »jenseits jeglicher Erfahrung« übersetzen kann. Eine weitere Variante geht den Umweg über das griechische »catadupe« - der Wasserfall -, der hier den Zusammenhang zu »cat« (Katze) herstellt; auch eine Ableitung aus der nordischen Mythologie, wo Katzen Regen und Hunde enorme Windböen bedeuteten, ist nicht unmögllch.
Es schreit zum Himmel...rufen wir aus, wenn eine Ungerechtigkeit so groß, so unglaublich ist, daß die himmlischen Mächte angerufen werden, für Gerechtigkeit zu sorgen. Im Alten Testament sprach Gott zu Kain, der eben seinen Bruder Abel erschlagen hatte: »Dixitque ad eum quid fecisti vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra« - »Er aber sprach Was hastu gethan? Die stim deines Bruders blut schreiet zu mir von der Erden«. (Genesis 4.10) Ein »himmelschreiendes« Unrecht war geschehen.
Es stinkt zum Himmel...wenn etwas empörend, anrüchig, fragwürdig ist - irgendwas stimmt einfach nicht. Die Redensart geht auf William Shakespeares (1564-1616) Drama »Hamlet« zurück: König Claudius hält einen selbstanklagenden Monolog, denn er hat den alten König vergiftet, der zudem sein Bruder und der Vater von Hamlet war: »O meine Tat ist faul, sie stinkt zum Himmel«.
Es wär' so schön gewesen...es hat nicht sollen sein. Dieser Stoßseufzer drückt unsere Enttäuschung aus, wenn etwas nicht so gekommen ist, wie wir es uns vorher erhofft und ausgemalt haben. Das Zitat geht auf das Versepos »Der Trompeter von Säckingen, ein Sang vom Oberrhein« von Joseph Victor von Scheffel (1826-86) aus dem Jahe 1854 zurück, wo es in jung Werners Lied im 2. Stück (XII.) heißt:
»Das ist im Leben häßlich eingerichtet,
daß bei den Rosen gleich die Dornen stehn,
und was das arme Herz auch sehnt und dichtet,
zum Schlusse kommt das Voneinandergehn.
In deinen Augen hab' ich einst gelesen,
es blitzte drin von Lieb und Glück ein Schein:
B'hüt dich Gott, es wär zu schön gewesen,
behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein.
Behüt dich Gott, es wär so schön gewesen,
behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein...«
Es wurmt mich...daß ich was machen mußte, das ich so nicht wollte, es ärgert mich, ist mir unangenehm, peinlich und es windet sich wie ein Wurm immer wieder durch den Kopf und läßt mich nicht mehr los: Wurmdämonen kommen aus dem germanischen Volksglauben, nach dem uns allerlei Übermächte Gutes oder Böses zufügten. Meist blieben sie unsichtbar, gelegentlich nahmen sie aber auch Wesen und Gestalt von allerhand »Gewürm« an, das dann durch Mund, Nase und andere Körperöffnungen eindrang und sein Unwesen in unseren Leibern trieb. Der »Kopfwurm« wütete manchmal gar so arg, daß man an Wahnsinn und Depressionen litt und ihn sich beim Wunderheiler »aus der Nase ziehen« lassen mußte. Gut möglich, daß tatsächlich »der Wurm drin« war - der Quacksalber mit viel Brimborium einen verirrten Spulwurm entfernte, der bei einem vorhergegangenen Erbrechen hinter die Gaumensegel oder in der Nase geraten war. Vielleicht wurde aber auch einfach nur die allgemeine Abneigung gegenüber solchen Parasiten auf unser Unbehagen projiziert.
Es zieht wie Hechtsuppe...sagen wir seit dem 19. Jahrhundert, wenn ein starker Luftzug durchs Zimmer weht. Die Herkunft dieses Ausdrucks ist nicht geklärt: Viele Quellen vermuten eine Verbindung mit dem hebräischen »hech supha«, was sinngemäß übersetzt etwa »wie eine Windsbraut« oder »sturmartig« heißt. Die Tatsache, daß dieses »hech supha« keine einzige jiddische Aufzeichnung jemals erwähnt, spricht allerdings nicht gerade für die Richtigkeit dieser Annahme. Manche glauben denn auch eher, daß die Wendung nur auf einem Wortspiel beruhen könne, da die mit viel Zwiebeln recht scharf gewürzte Fischsuppe lange ziehen muß, um schmackhaft zu werden. Auch das daraus folgende Brennen im Mund wurde oft als »ziehen« beschrieben.
Eselsbrücke...nennen wir etwa seit dem 19. Jahrhundert einen kleinen Merkspruch oder einen Reim, der als Gedächtnisstütze dem besseren Erlernen oder Behalten von Daten und Fakten dient. Man geht einen kleinen Umweg, betreibt einen besonderen Aufwand, um dennoch schneller - oder überhaupt erst - ans Ziel zu gelangen.
Das Wort bezog sich einst auf ein Zitat von Gaius Plinius Secundus (um 23-79): Jener behauptete, daß ein Esel keine Brücke überschreite, durch deren Belag er das Wasser sehen könne, womit er sich auf die griechischen Lehrsätze von Euklid und Pythagoras berief. Nach anderer Meinung weigert sich das Tier beharrlich, selbst die kleinsten Wasserläufe zu durchwaten, da es sehr wasserscheu ist und durch die spiegelnde Wasseroberfläche nicht erkennen kann, wie tief der Bach ist. Also baute man früher häufig kleine Brücken in Furten, um mit den Eseln trotzdem ans Ziel zu gelangen.
Eine schöne »Eselsbrücke«, um sich zu merken, auf welcher Seite sich Luv (die dem Wind zugewandte) beziehungsweise Lee (die abgewandte Seite eines Schiffes) befindet, kennt wohl jeder, der schon mal seekrank geworden ist: »Kotzt du nach Luv, kommt's wieder ruff, kotzt du nach Lee, geht's in die See«...
Eselsohren...knickt mancher kurzerhand als Lesezeichen in seine Bücher. Einst auch in Visitenkarten gefaltet, konnte man diese besser vom Silbertablett aufnehmen. Ungewollte Eselsohren als Ergebnis grober Unachtsamkeiten begründen die sprichwörtliche Bedeutung der Eselsdummheit, die optische Form des Knicks ähnelt nur sehr entfernt dem Ohr eines Esels.
Neuerdings nerven auch diverse Internetseiten mit Eselsohren (Pagepeel, Magic Corner), ein Script, hinter dem sich meist sinnlose Reklame versteckt.
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen...sagt ein uraltes Sprichwort: Essen und Trinken spielen eine große Rolle in unserem kulturellen Leben, der Körper verlangt Nahrung, damit er die Energie bekommt, seine »Arbeit« zu leisten. Die Seele genießt es, in Gemeinschaft zu essen - eine Feier ohne ausgiebiges Festmahl wäre undenkbar und selbst Probleme lassen sich bei einem guten Essen viel besser besprechen.
Für den griechischen Philosophen Platon (427-347 a.C.) war der Körper das Gefängnis der unsterblichen Seele, aus dem sie sich erst durch den Tod befreien könne - solange Leib und Seele jedoch zusammen sind, ist der Mensch am Leben.
»Weil Speis und Trank in dieser Welt doch Leib und Seel' zusammenhält« schrieb Hinrich Hinsch in das Libretto für das 1690 vom Komponisten Johann Philipp Förtsch (1652-1732) erdachte Singspiel »Der irrende Ritter Don Quixotte de la Mancia«.
Essen wie ein SpatzWer wie ein Spatz ißt, ißt sehr wenig, nur so winzige Portionen, wie sie eigentlich nur dem kleinen Sperling genügen könnten. Eigentlich widersinnig, da gerade so kleine Vögel ob ihres intensiven Stoffwechsels besonders gierige Fresser sind und im Verhältnis zu ihrer Körpermasse extrem viel Futter brauchen.
Etepetete...kam im 19.Jahrhundert in Berlin auf. Die Herkunft ist nicht ganz sicher, aber man kann Anklänge ans Französische/Niederländische feststellen: In der französischen Sprache wird »être, peut-être« mit »kann sein, vielleicht« bzw. »mehr scheinen als sein« übersetzt. In Holland steht »Ete« für »Essen«, »Partaat« für »Kartoffeln«. Auch möglich ist eine Umbildung aus »öte«, »ete«, das man besonders im Mecklenburgischen kennt. Das Substantiv »Ötigkeit« meint dort »geziertes Wesen«, eine übermäßig feine Person ist »etepetete«, also »geziert, zimperlich, umständlich und überfein«.
Etwas am Hals habenMan hat gerade Ärger oder wird mit etwas belastet, was Mühe macht. Die Redewendung kommt vom Tragjoch, einer Stange, die auf dem menschlichen Nacken getragen wird und an deren Enden mithilfe von Seilen zwei gleich schwere Lasten angehängt werden. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war das Tragjoch eines der wichtigsten Transportmittel der Welt. In Deutschland kommt es kaum noch zum Einsatz, in ärmeren Ländern haben es die Menschen immer noch am Hals.
Etwas andrehenDer Ausdruck kam einst aus der Ganovensprache in die der Verkäufer und beschreibt ein simples Täuschungsmanöver, bei dem der Händler einen nicht einwandfreien Gegenstand beim Verkauf so dreht, daß der Mangel für den Käufer nicht erkennbar ist.
Etwas anhängen...war im Mittelalter gängiger Rechtsbrauch, Übeltätern als Zeichen für ein Vergehen einen dazu passenden Gegenstand, Verurteilten auf dem Scheiterhaufen ein Schild, auf dem die Missetat vermerkt war, um den Hals zu hängen und ihn damit herumzuführen. Gotteslästerern und zänkischen Weibern wurde ein Lasterstein um den Hals gehängt, letzteren auch schon mal ein Besen, den sie dann durch die Straßen tragen mußten, für Diebe gab es den gestohlenen Gegenstand, für Trunksüchtige die Schandflasche, Huren trugen Steine in obszönen Formen etc.
Etwas ankreiden...geht auf einen Brauch von Gastwirten zurück: Schulden von Zechern wurden mit Kreide auf einer Tafel vermerkt, um nicht vergessen zu werden. Diese Praxis ist bereits in einem Lied aus dem 15. Jahrhundert belegt.
Etwas auf dem Kerbholz habenKerbhölzer oder -stöcke waren bis in das 19. Jahrhundert Schuldbücher, wichtige Utensilien zur Aufzeichnung von Lieferungen und Leistungen, als schriftliche Aufzeichnungen noch nicht üblich waren. Für jeden einzelnen Vorgang wurde mit dem Messer eine Kerbe in ein längsgespaltenes Holz, schon in der Altsteinzeit vor 30.000 Jahren in Knochen, die paßgenau übereinandergelegt werden konnten, geschnitten. Einen Teil behielt der Gläubiger, der andere wurde dem Schuldner übergeben. Kamen neue Aufzeichnungen hinzu, legte man die beiden Teile paßgenau aneinander und schnitt in beide Hälften identische Kerben. So konnten sich beide sicher sein, daß die Schulden nicht manipuliert wurden. Am Zahltag wurde das Kerbholz präsentiert, mit dem Gegenstück verglichen und zur Zahlung aufgefordert.
Etwas auf der Pfanne haben...soll heißen, daß jemand etwas Besonderes kann. Diese Wendung hat aber nichts mit Kochen zu tun - gemeint ist hier die Pfanne früher Lunten- u. Steinschloßgewehre: So wurde die kleine Mulde genannt, in die man das Zündpulver füllte. Man war also ursprünglich »zum Schießen bereit«. Wer was »auf der Pfanne« hatte, war dadurch seinen Gegnern überlegen.
Etwas ausgefressen haben...wir - irgendwas »Schlimmes« angestellt, was wir besser nicht hätten tun sollen, vom harmlosen Schuljungenstreich bis hin zur Straftat.
Man geht davon aus, daß diese Redewendung auf die »Hauswüstung«, einen mittelalterlichen Rechtsbrauch, gründet: Konnte oder wollte jemand seine Schulden nicht bezahlen, ordnete das zuständige Gericht eine »Partialwüstung« an. Der Schuldner bekam sogenannte »Fresser« ins Haus einquartiert. Diese verbrauchten solange die Vorräte des Schuldners, bis der entweder zahlte oder das Haus verließ - mindestens, bis alles verbraucht und die Vorratskammer »ausgefressen« war. So nahm man ihm jegliche Existenzgrundlage.
Eine andere Deutung bezieht diese Wendung ursprünglich auf Haustiere, die sich etwas Freßbares stibitzt hatten und nun ihrer gerechten Strafe entgegensahen.
Etwas ausreizen...bedeutet, etwas voll ausschöpfen, alle Möglichkeiten nutzen, ausloten, bis zu welcher Grenze man gehen kann. Die Redensart kommt vom Skatspiel: Jeder Spieler will mit den gegebenen Karten das bestmögliche Ergebnis erreichen. Er versucht also, beim Reizen den Gegner zu einem höheren Spiel herauszufordern, indem er das höchste mit dem vorhandenen Blatt mögliche Spiel ansagt - auch auf die Gefahr, zu überreizen und das Spiel so zu verlieren.
Etwas checken...bedeutete im Englischen ursprünglich »to check«, Schach bieten: Beim Schachspiel sind Angreifer und Verteidiger ständig damit beschäftigt, alle Möglichkeiten des Schachbietens oder Verhinderns durchzuprüfen - also zu »checken«.
Etwas deichselnWir glauben, daß wir irgendeine Sache durch flexiblen Einsatz unserer Fähigkeiten zu einem guten Abschluß bringen können: Diese Redensart geht auf das Rückwärtsrangieren eines unbespannten Pferdewagens an der Deichsel zurück. Mithilfe der Deichsel, an der normalerweise die Zugtiere der Wagen ziehen, wird dieser rückwärts »eingeparkt« - für manche eine schwierige Sache, die viel Geschick erfordert...
Etwas gründlich abklopfenWir haben eine Arbeit vollendet und lassen sie von einem Dritten auf Fehler und Schwachstellen untersuchen. Diese Wendung geht auf eine ärztliche Untersuchungstechnik zurück: Beim Abhören mit dem Stethoskop klopft der Arzt leicht auf den Körper. Aufgrund des Klopfschalls kann er dabei verschiedene Erkrankungen erkennen.
Etwas im Urin haben...meint, daß man etwas ahnt oder intuitiv spürt, sei es aufziehender Ärger oder ein gutes Geschäft: Von der Antike bis ins Mittelalter untersuchten Ärzte den Urin ihrer Patienten, um die Ursache ihrer Beschwerden und Krankheiten zu erkennen. So waren Farbe, Geruch und auch Geschmack wesentlich für die Diagnose. Galenos von Pergamon (2. Jahrhundert) war einer der Ersten, der besonderen Wert auf die Analyse des Harns legte.
Etwas in der Hinterhand habenWir haben einen Plan und beschreiben ihn, ohne jedoch alle Feinheiten zu verraten, lassen allen Anderen den Vortritt und behalten so einige unserer Argumente »in der Hinterhand«, um zum rechten Zeitpunkt damit glänzen zu können. Die Redensart kommt aus dem Skatspiel: Derjenige, der seine Karte als letzter ausspielt, kann - so er mit hohen Karten gut bestückt ist - den »Stich« machen und entscheidende Punkte sammeln. Er kann seine Trümpfe ausspielen, immer noch reagieren, wenn die anderen Spieler ihre Karten längst ausgespielt haben.
Etwas ist besiegelt...wenn eine Entscheidung nach langem Hin und Her endlich getroffen worden ist und nichts mehr geändert werden soll. Das Wort geht auf das lateinische »sigillum« zurück - ein »Bildchen«, das in weiches Material gedrückt aushärtete und somit Beweis für die Vertragsgültigkeit war.
Etwas ist faul im Staate Dänemark...wenn wir Probleme, Unangenehmes, oder etwas, das nicht in Ordnung ist vermuten. Der Spruch geht auf William Shakespeares (1564-1616) Tragödie »Hamlet« (um 1601) zurück, in der der Wachoffizier Marcellus, ein Begleiter des Protagonisten, als sie auf das Erscheinen des Geistes von Hamlets ermordetem Vater auf der Burgmauer warten, argwöhnt:
»Something is rotten in the state of Denmark«.
Hamlet will der Erscheinung folgen, Marcellus und Horatio ihn davon abhalten; schließlich lassen sie ihn mit dem Geist alleine - ahnen jedoch, daß etwas Böses geschehen sein muß.
Vermutlich liegt dem geflügelten Wort aber ein Übersetzungsfehler zugrunde: Hamlet wird auch als »Dänemark« bezeichnet, mit »State« ist wohl sein Geisteszustand gemeint. Damit wäre in der Übersetzung »etwas krank im Kopfe von Dänemark, also Hamlet«.
Etwas läuten hören...wir, wenn wir durch noch vage Andeutungen oder Gerüchte von etwas erfahren: Natürlich läuten hier Kirchenglocken - zum Gottesdienst mehrere gemeinsam, für die Uhrzeit meist nur einzelne, oft können sich hinter dem Geläut aber auch ganz andere Nachrichten oder Mitteilungen - zum Beispiel ein Feueralarm - verbergen. Deshalb gilt: Ohren spitzen, aufmerksam und wachsam sein und der Sache erstmal auf den Grund gehen.
Etwas niedriger hängen...Leute, die gelegentlich auch mal Abstriche machen, ihre eigenen Erwartungen zurückschrauben, etwas nicht wichtiger nehmen, als es eigentlich ist.
Der Ausdruck geht auf einen Vorgang zurück, der sich anno 1781 in Berlin abgespielt haben soll:
Als der »Alte Fritz« Friedrich der Große (1712-86), der den Kaffeekonsum seiner Preußen drastisch einschränken wollte, eines schönen Tages bei einem Ausritt zu einem Platz kam, an dem eine Volksmenge eine hoch oben an einer belebten Ecke angeschlagene Karikatur von ihm mit einer Kaffeemühle betrachtete, erwarteten die Versammelten einen furchtbaren Wutausbruch - doch der König rief, man solle das Bild doch etwas niedriger hängen, damit sich die Leute den Hals nicht ausrenken und ritt ganz entspannt weiter.
Etwas pumpen...muß sich so mancher, der kein Geld mehr hat. Er muß sich etwas ausleihen, während er auf den Zahltag wartet. In unserer Metaphorik kann eine (Geld-)Quelle sprudeln, aber auch versiegen, Ebbe in der Kasse sein, wir können jemandem den Geldhahn zudrehen, wer auf dem Trockenen sitzt, wird sich auf einen warmen Geldregen freuen. Oftmals wird die Geldversorgung bildlich mit unserer Wasserversorgung gleichgesetzt - so auch beim »pumpen«, ursprünglich in der Gaunersprache »pompen«, für »etwas borgen, leihen«. Einer soll dem anderen etwas Geld in die leeren Taschen pumpen, damit der Kreislauf wieder funktioniert, derjenige wieder »flüssig« ist.
Etwas schnallen...heißt, daß man komplizierte Sachverhalte nach einer gewissen Zeit endlich begreift, eine Lösung gefunden hat. Der Ausdruck kommt ursprünglich aus der Jägersprache: »Einen Hund schnallen« bedeutet dort, ihn von der Leine zu lassen, damit der den Weidmann zur verwundeten oder toten Beute führt.
Etwas spickenMehr oder weniger unbewußt »spicken« wir unsere Sätze oft mit Redensarten oder Fremdwörtern. Das macht unsere Sprache bunter und bildhafter. Der Ausdruck kommt vom Kochen: Mageres Fleisch wird oft mit Speckstreifen »gespickt«, indem diese hineingesteckt bzw. durchgezogen werden. Dadurch bleibt das Fleisch beim Erhitzen saftiger, der Geschmack verbessert sich erheblich - wie auch unsere Sprache durch die Redensarten...
Etwas springen lassen...heißt, in Geberlaune zu sein und anderen etwas zu spendieren. Die Redensart greift den früheren Brauch auf, beim bezahlen die Münzen auf dem Tisch aufspringen zu lassen, um durch den Klang zu zeigen, daß das Geld echt ist und, daß man überhaupt zahlungsfähig ist.
Eulen nach Athen tragen...geht auf den griechischen Dichter Aristophanes (um 445-385 a.C.) zurück, der den Ausspruch in seiner Komödie »Die Vögel«, in der er seine Heimatstadt Athen mit all ihren Schwächen glossiert, prägte. In Vers 301 wird eine herbeifliegende Eule mit den Worten: »Wer hat die Eule nach Athen gebracht?« kommentiert.
Die in Athen vor allem in den zerklüfteten Hängen der Akropolis häufigen Vögel, Symbol der Athene, der Schutzgöttin der Stadt, symbolisierten Klugheit, da sie auch im Dunkeln sehen können. Man könnte die Worte also als Hinweis auf die recht unsinnige Tätigkeit deuten, Klugheit in die Stadt bringen zu wollen.
Wahrscheinlicher ist indes, daß das Sprichwort sich auf die Münzen bezog, auf denen das Tier prangte. Aristophanes bezeichnete es als überflüssig, ins reiche Athen Silbermünzen zu schicken, da die Athener so reich seien, weil in ihren Geldbeuteln »Eulen« nisten und Junge ausbrüten. In Vers 1106 schreibt er dazu: »An Eulen wird es nie mangeln«.
Ähnlich ist auch das lateinische »ligna in silvam ferre« - »Holz in den Wald tragen« (Horaz, Satiren I, 10, 34) zu verstehen.
Eulenspiegelei...nennen wir mutwillige Streiche, den einer einem anderen spielt, indem er dessen Anweisungen absolut wörtlich nimmt. Das Wort geht natürlich auf den wohl berühmtesten aller Narren Till Eulenspiegel zurück, der in seinem Leben allerhand Schabernack getrieben haben soll. Um das Jahr 1515 schrieb Hermann Bote 96 Episoden aus dessen eigentlich durchaus tragischen Leben zusammen.
Ewig und drei TageDas mittelalterliche Verkehrswesen war schlecht, die elektronische Kommunikation noch in weiter Ferne, sodaß Fristen oft nicht eingehalten wurden. Daher setzte die Rechtssprechung einen bestimmten Zeitraum fest und gab dafür als Zugabe drei Tage - erst danach war eine Frist entgültig abgelaufen. Je nach Sichtweise konnte der festgesetzte Zeitraum eine Ewigkeit bedeuten...
Ewiger PfennigZu Zeiten der »Münzverrufung« im späten Mittelalter, aber auch in der frühen Neuzeit, war die Prägung von »Ewigen Pfennigen«, die vom Münzherren nicht verrufen werden konnten, die einzige Chance, sich vor der Zwangsentwertung zu schützen.
Ewiggestrig...nennen die Medien dieser Tage gern Menschen, die an altbewährten Traditionen festhalten. Meist im Zusammenhang mit den höchst merkwürdigen Vorstellungen, die unsere Politiker in so schöner Regelmäßigkeit propagieren, ist das Wort heute durchweg abwertend konnotiert: Wir sollen uns nur ja der »neuen Lebenswirklichkeit« anpassen, den »veränderten gesellschaftlichen Bedingungen« Rechnung tragen - sprich: Den kruden Ideen und Zielen einer Politik entsprechen, die schlicht und ergreifend längst versagt hat. Daß es in Wahrheit völlig sinnlos und oft gar gefährlich ist, blind jeder Veränderung nachzulaufen, ist überall in unserer heutigen Gesellschaft deutlich zu erkennen.
In einer ganz anderen Zeit liegt denn auch der Ursprung - in einem Zitat aus Friedrich von Schillers (1759-1805) Tragödie »Wallensteins Tod« (I.4). In seinem Monolog zögert der Heerführer, den Abfall vom Kaiser zu vollziehen, weil er erkennt:
»Ein unsichtbarer Feind ist's, den ich fürchte,
Der in der Menschen Brust mir widersteht,
Durch feige Furcht allein mir fürchterlich.
Nicht, was lebendig, kraftvoll sich verkündigt,
Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz
Gemeine ist's, das ewig Gestrige,
Was immer war und immer wiederkehrt
Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten!«
Ex & hopp...sagt der Volksmund, wenn jemand etwas schnell benutzt und dann (die Reste) gleich wegwirft. Diese Wendung, die heute für Leichtfertigkeit, Unverbindlichkeit und Rücksichtslosigkeit steht, stammt aus dem Jahre 1967 und geht auf eine Werbeaktion von 50 Brauereien zurück, die damit die Einwegflasche propagierten und das Bierflaschenpfand abschaffen wollten. Die »Ex & hopp«-Flasche und -Dose gibt es bis heute - seit 2003 nunmehr mit Pfand. Und das ist inzwischen gar ca. dreimal höher als bei der Pfandflasche.
© tantalosz webdesign 2007 - 2026